|

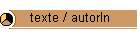

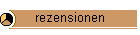



| |
Torsten Bewernitz:
Give the Anarchist a theory
Renaissance des libertären Kommunismus?
Vielleicht ist es ja ein
subjektiver Eindruck – aber scheinbar sind in den letzten anderthalb Jahren so
viele Bücher über den Anarchismus erschienen wie in kürzerer Vergangenheit
selten zuvor. Teilweise lässt sich das mit dem 70jährigen Jubiläum der
Spanischen Revolution erklären, teilweise, wie im Falle des Anarchismus-Bandes
in der Reihe theorie.org von Hans-Jürgen Degen und Jochen Knoblauch, ist es auch
einfach nur Zufall, war das Buch doch bereits seit zwei Jahren angekündigt.
Allerdings geht der Band dieser Tage auch schon in die zweite, überarbeitete
Auflage, das heißt, es verkauft sich scheinbar für einen kleinen, linken Verlag
sehr gut. Und vor einigen Wochen ist mit Horst Stowassers „Anarchie!“ im
Nautilus-Verlag quasi die Mega-Version dieser Einführung erschienen. Und behält
recht: Stowassers „Anarchie!“ schaffte es direkt auf Platz 1 der Buchtipps von
NDR und Süddeutscher Zeitung im Juni 2007. Darüber hinaus erschienen 2006 mit
Gerhard Senfts „Essenz der Anarchie“ (Promedia) und kürzlich mit Achim von
Borries’ und Ingeborg Weber-Brandies’ „Anarchismus – Theorie, Kritik, Utopie“
(Verlag Graswurzelrevolution) zwei Bände mit historischen Beiträgen von
AnarchistInnen. Während Senft anhand des Oberthemas „Parlamentarismus“ eine neue
Sammlung von Texten herausgab, ist die Textsammlung von Borries und
Weber-Brandies die Neuauflage eines bereits 1968 erschienen Sammelbandes.
In Folge dessen enthält
letztgenanntes Buch „Klassiker“, die anarchistischen ZeitgenossInnen der letzten
dreißig Jahre zum Großteil bekannt sein dürften: Es kursiert ja immer noch der
alte Witz, dass drei AnarchistInnen, wenn sie sich treffen, erst mal eine
Zeitung gründen. Und ebenso gerne geben sie Broschüren mit Texten des
traditionellen Anarchismus heraus. Horst Stowasser hat ganz recht, wenn er in
der Einleitung seines Buches betont, dass es eigentlich verwunderlich ist, wie
unbekannt die philosophischen Ideen des Anarchismus sind – angesichts der sehr
guten Literaturlage. Dazu hat er selber einiges beigetragen: Wer bereits
Stowassers „Freiheit pur“, „Leben ohne Chef und Staat“ oder auch seine jüngste
Publikation „Anti-Aging für die Anarchie“ (Edition AV) gelesen hat, dem wird an
„Anarchie!“ einiges bekannt vorkommen, denn dieser Band ist quasi die
konsequente Fortführung der früheren Einführungsbände. Senfts Band dagegen
bietet einige interessante, weniger bekannte Beiträge, etwa des Dichters Robert
Bodanski oder des Sozialdemokraten Raphael Friedberg.
Ja, richtig gehört: Des
Sozialdemokraten. Der Text Friedbergs nämlich, den Senft ausgesucht hat,
entstammt seiner Zeit bei der SPD. Damit sollte schon mal mit einem ersten, weit
verbreiteten Vorurteil aufgeräumt sein: Die vermeintlichen Gräben zwischen
SozialdemokratInnen, MarxistInnen und AnarchistInnen sind bei weitem nicht so
tief, wie gemeinhin angenommen wird. Selbstverständlich gibt es sie, unter
anderem deswegen, weil sich historisch die VordenkerInnen des Anarchismus
vorrangig aus DissidentInnen der parlamentarischen ArbeiterInnenbewegung
zusammengesetzt haben. Auch beispielsweise Rudolf Rocker, Vordenker des
Anarchosyndikalismus in Deutschland, entstammte den Reihen der
sozialdemokratischen „Jungen“ im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das Verhältnis der
„Jungen“ zur SPD in den 1870er Jahren ist teilweise vergleichbar mit jenem des
SDS zur SPD nach 1968. So war es denn auch die SPD, die in der Weimarer Republik
Anarcho-SyndikalistInnen ausschloss, weil sie nicht auf Linie waren – ein
Prozess, der sich mehrfach wiederholte, etwa in der Ausschlusswelle von
DissidentInnen aus dem DGB Anfang der 1970er Jahre oder jüngst mit der Gründung
der WASG.
Die verschiedenen
Strömungen der Arbeiterbewegung – demokratischer Sozialismus/Reformismus
(Sozialdemokratie), autoritärer Sozialismus und libertärer Kommunismus
(Anarchismus) – miteinander zu vergleichen, darf nicht nur eine
Auseinanderdifferenzierung der Entwicklungen dieser Strömungen beinhalten,
sondern muss ebenso die gemeinsamen Wurzeln reflektieren. Unbestreitbar hat ein
sich an Stalin orientierender „Marxismus“-Leninismus mit dem libertären
Kommunismus gar nichts mehr gemein. Dennoch sind die gemeinsamen Wurzeln von
Marxismus und Anarchismus bis heute spürbar. Westlicher Marxismus à la Adorno/Horkheimer,
der sogenannte „Revisionismus“ von Karl Korsch oder Georg Lukács wie auch der
italienische Operaismus oder die wertkritische Schule – wenn diese auch vom
Anarchismus massiv divergiert, weil sie die Subjekte der Revolution theoretisch
entmündigt – sind Aspekte sozialistischer Theorien, mit denen sich
AnarchistInnen bei weitem zu wenig auseinandersetzen. Ich würde sogar so weit
gehen zu behaupten, dass sich post-1989er Sozialismus-Theorien, die sich mit
Hilfe poststrukturalistischer Ansätze vom autoritären Staatssozialismus
abgrenzen, unter dem Begriff Anarchismen subsumieren lassen.
Die Niederschlagung des
Aufstands von Kronstadt, der gemeinsame Kampf der Roten Armee und der „weißen“
Armeen der deutschstämmigen Adeligen gegen die libertäre Machnotschina in der
Ukraine, der stalinistische Verrat an der Spanischen Revolution, die
Einkerkerung von AnarchistInnen im post-„revolutionären“ Kuba und viele andere
Ereignisse, ebenso wie polemische Propagandaschriften1
führten dazu, dass AnarchistInnen sich von allem, was sich „Marxismus“ nannte,
zu Recht distanzierten. Victor Serge, einer der wenigen AnarchistInnen, die in
der KPdSU verblieben, diagnostiziert: „Die Affäre von Kronstadt, diese letzten
Tragödien [...] sollten von da an einen unüberschreitbaren Graben zwischen
Marxisten und Anarchisten ziehen. Und diese Trennung sollte später in der
Geschichte eine verhängnisvolle Rolle spielen: sie war eine der Ursachen der
intellektuellen Verwirrung und des Scheiterns der spanischen Revolution“ (in:
Borries/Weber-Brandies, Seite 168). Solche politisch-marxistischen Brutalitäten
gegen Libertäre haben sich tief in die Erinnerungskultur des Anarchismus
eingegraben. Hinzu kam der historische Konflikt zwischen Karl Marx und Mikhail
Bakunin in der Ersten Internationalen, auf den sich AnarchistInnen gerne bis
heute berufen, um eine unüberwindliche Spaltung zu betonen. Dabei standen sich
die Egomanen Marx und Bakunin in Sachen Intriganz kaum nach. Paul Pop hat an
dieser Stelle kürzlich den lohnenswerten Versuch unternommen, die Grenzen
zwischen autoritärem und antiautoritärem Sozialismus neu zu begutachten und zu
bewerten und fand eine nachvollziehbare Linie von Bakunin zu Lenin einerseits
und von Marx zu Kropotkin andererseits.2
Die Überbetonung der
Differenz führt sowohl zu Fehlinterpretationen der Theorien der politischen
MarxistInnen wie aber auch zu falschen Gewichtungen in den Anarchismen. Genau
diese Vereinfachung des ambivalenten Verhältnisses zwischen den Strömungen der
ArbeiterInnenbewegung führt Gerhard Senft zu der Behauptung, die
„Parlamentarismuskritik“ wäre die „Essenz der Anarchie“, wie auch
Graswurzelrevolution-Koordinationsredakteur Bernd Drücke in seiner Rezension des
Buches betont hat: „Der ‚Hauptfeind’ des Anarchismus war und ist nicht der
Parlamentarismus [...]“.3
Das belegt nicht nur der Text Friedbergs, sondern auch Texte von AnarchistInnen,
die niemals Mitglied einer parlamentarischen Partei waren. Pjotr Kropotkin,
Erich Mühsam (der allerdings zeitweise Mitglied der KPD war) und auch Helmut
Rüdiger (der sich nach dem Zweiten Weltkrieg der sozialistischen Partei
Schwedens anschloss, nichtsdestotrotz aber aufrechter Syndikalist blieb)
kritisieren in den Texten, die Senft ausgewählt hat, zwar durchaus den
Parlamentarismus, sie sind aber in ihrer Kritik bei weitem nicht so radikal,
dass sie ihn nicht als Fortschritt gegenüber autokratischen Systemen betrachten
und ihm positive Aspekte abgewinnen können.
Insbesondere bei dem Band
Borries’ und Weber-Brandies’ erhält sich der Eindruck, die Texte wären danach
ausgewählt, dass sie eine möglichst vehemente Kritik am Marxismus äußern. Kein
Thema nimmt mehr Platz und mehr Aufsätze ein als die Kritik des
bolschewistischen Russlands. 1968, als dieses Buch zum ersten Mal erschien, mag
diese Herangehensweise notwendig gewesen sein, nach dem Zusammenbruch des realen
Staatskapitalismus sollte man sich aber auf Gemeinsamkeiten in der Theorie und
den Forderungen besinnen – ohne deshalb die Verbrechen eines Leninismus,
Stalinismus und Maoismus zu verschweigen. Das scheint auch den AutorInnen
bewusst zu sein: Einer der interessantesten Texte des Sammelbandes ist Borries’
Kommentar zu Bakunin. Ausführlich zitiert Borries aus Bakunins Schreiben an die
„Allianz der Sozialen Demokratie“ in Spanien, in dem Bakunin Marx’ theoretische
Errungenschaften sehr deutlich würdigt. Ebenso aufschlussreich an diesem
Kommentar ist die Beschreibung von Bakunins Utopie: Die Revolution und die
postrevolutionäre Ordnung sind für ihn Sache einer „unsichtbaren“ Diktatur
„eines revolutionären Ordens“ (Seite 345). Gegen Bakunins unsichtbare Diktatur
ist die Marx’sche „Diktatur des Proletariats“ (ein Begriff übrigens, der bei
Marx selber kaum eine Rolle spielt), die nichts weiter meint, als die
(wahrscheinlich nicht gewaltfreie) Aneignung der Produktionsmittel durch die
mittellosen ArbeiterInnen, das gerechtere und demokratischere Mittel.
Desiderata des Anarchismus
Horst Stowasser betont
nachdrücklich, dass der Anarchismus jenseits seines Minimalkonsenses
„Herrschaftsfreiheit“ beliebig sei. AnarchistInnen, so Stowasser weiter, würde
das auch nicht weiter stören, im Gegenteil sei dies sein großer Vorteil (Seite
16). AtheistInnen seien hier ebenso zu finden wie Religiöse, MaterialistInnen
wie EsoterikerInnen. Nun sollte sich erst einmal schon jedeR, der/dem es denn um
„Herrschaftsfreiheit“ geht, die Frage stellen, ob sie/er denn mit „Religiösen“
oder gar „EsoterikerInnen“ wirklich mehr gemein hat als mit Partei- oder
StaatssozialistInnen – zumal wenn sich letztere gar nicht auf den historischen
„real existierenden Sozialismus“, sondern nur auf dessen TheoretikerInnen
beziehen. Wenn ein autoritärer Materialist die Welt erklärt, so ist dies auch
für AnarchistInnen allemal gewinnbringender, als wenn die Welt aus dem höheren
Willen eines Gottes, eines Dämons, eines Spaghettimonsters oder einer mythischen
Pyramide zusammenphantasiert wird. Der Anarchismus tendiert oft zu einer
repressiven Toleranz gegenüber ungaren Welt- und Gesellschaftserklärungen, die
ein Erkenntnis- und Veränderungsinteresse nicht nur massiv behindern, sondern
teilweise bedrohlich sind. Diese repressive Toleranz offenbart sich in einer
offenen Flanke zu Antisemitismus, Verschwörungstheorien und einem ökonomischen
Hasadeurtum, das stark an die halbgaren Konzepte des Neoliberalismus erinnert.
Nicht zuletzt besteht diese offene Flanke auch gegenüber einem Nationalismus.
Letzterer ist gerade in dem Sammelband aus dem Graswurzelverlag deutlich zu
spüren: In den Beiträgen Godwins, Proudhons, Bakunins, Kropotkins und selbst
Landauers wimmelt es von Lobeshymnen auf die Nation. Erst der Beitrag Emma
Goldmans „Patriotismus – eine Bedrohung der Freiheit“ (Seite 145–152) findet
deutliche Worte gegen den Nationalismus. Goldmans Vortrag, publiziert 1911,
richtete sich an die amerikanischen ArbeiterInnen und wendete sich gegen einen
US-amerikanischen, militaristischen Patriotismus. Ihr Beitrag wäre heute
wahrscheinlich als „antiamerikanisch“ verpönt – und ist dennoch so aktuell wie
seinerzeit (keineswegs nur die USA betreffend).
Weil der Anarchismus sich
bisher so beliebig generiert, bietet er eben auch allen Verrücktheiten Platz.
Gerhard Senft etwa ist der Extremegoist Max Stirner ein „Vordenker des
Anarchismus“. Horst Stowasser dagegen hat in seinem Buch die einfache Formel
„Anarchismus gleich Freiheit plus Sozialismus“ betont. Bei Max Stirner irgendwo
einen Sozialismus zu finden – das ist eine Kunst für sich. Hans Jürgen Degen und
Jochen Knoblauch betonen daher auch, dass Max Stirner kein Anarchist war,
rezipieren ihn aber dennoch stark in ihrer Anarchismus-Einführung und auch nicht
ganz zu Unrecht, denn sein (unheilvoller) Einfluss auf das Denken Bakunins ist
unabstreitbar. Die ökonomischen Konzepte Proudhons und Bakunins zu Ende gedacht,
finden wir uns in einem Neoliberalismus wieder, der an sozialer Ungerechtigkeit
den aktuellen ökonomischen Zustand bei weitem übertreffen würde. Beide wollen
nichts weiter als die gleichen Chancen auf dem Markt. Der staatsfeindliche
Neoliberalismus in extremer Form will dasselbe: Die gleichen Einstiegschancen in
den freien Markt für alle. Es gäbe ein Hauen und Stechen, das dem bürgerlichen
Verständnis von „Anarchie“ sehr nahe kommt, wenn es dieses nicht gar übertrifft.
Die eine von drei Grundprämissen des Anarchismus – soziale Gleichheit neben
sozialer Gerechtigkeit und Freiheit – wird hier nur als gleiches „Startkapital“
eingeplant.
Es mangelt bei Proudhon,
Stirner und Bakunin an einer marxistischen Grundprämisse, die Kropotkin dann
endlich benannt hat: die Abschaffung des Privateigentums, insbesondere des
Eigentums an Produktionsmitteln. Proudhon und Bakunin haben die Gewaltförmigkeit
des Marktes bei weitem unterschätzt. Unter anderem lag dies sicherlich an ihrem
Erfahrungshintergrund. Zu Proudhons Lebzeiten war der moderne Kapitalismus
gerade erst im Entstehen, Bakunin entstammte einem Land – Russland –, das noch
zu Zeiten der Oktoberrevolution agrarisch geprägt war. In dem Beitrag „Die
russische Revolution und das autoritäre Prinzip“ von 1924 (in: Borries/Weber-Brandies,
Seite 194) kritisiert Emma Goldman an der Marx’schen Theorie, dass eine
Gesellschaft ihr zufolge einen gewissen Entwicklungsstand erreicht haben müsse,
um eine soziale Revolution durchzuführen, und argumentiert mit der „slawischen
Psyche“. Schließlich hätte in den entwickelten Staaten Deutschland oder USA im
Gegensatz zu Russland keine Revolution stattgefunden. Emma Goldman behält
kultürlich insofern recht, als dass keine Revolution stattfindet, ohne dass
potentiell revolutionäre Subjekte diese wollen. Bei aller anarchistischen
Weitsicht gegenüber dem sozialdemokratischen Projekt (auch die russischen
Bolschewiki waren nichts anderes als „sozialdemokratische Maximalisten“, so
Kropotkin) konnte sie aber auch die weitere Entwicklung des Sowjetunionismus
nicht abschätzen. Wie Karl Marx die strukturellen Prämissen einer Revolution
überschätzt haben mag, bzw. seine ApologetInnen die Struktur später
überbewerteten, so unterschätzt Goldman diese: Aus dem agrarischen und
zaristischen Russland konnte aus strukturellen Gründen kein freiheitlicher
Sozialismus werden, so wenig wie aus der DDR nach der Erfahrung des
Nationalsozialismus. Ein bereites „Volk“ reicht nicht aus für die soziale
Revolution, sondern höchstens für eine politische oder institutionelle.
„Gewohnheiten“ aus der alten Gesellschaft legt man nicht von heute auf morgen
ab, Diskurse sind beständig und unberechenbar. Das Missverständnis der
anarchistischen Denkschulen liegt darin, den Wunsch und das Begehren nach einer
Revolution mit ihrer Möglichkeit zu verwechseln. Der Marx’sche Fehler auf der
anderen Seite liegt darin, aus der Struktur (in diesem Falle des Kapitalismus)
abzuleiten, dass eine Revolution notwendigerweise zum Sozialismus und
Kommunismus führt. Traditioneller Anarchismus und Marxismus haben nicht nur
ethische und politische Grundwerte gemeinsam, sondern auch ein lineares
Geschichtsbild, nach dem die Geschichte unweigerlich in einem Kommunismus
„enden“ müsse. Die Möglichkeit des Kommunismus bedeutet aber noch lange nicht,
dass eine Revolution notwendig zu einer bestimmten Form der
Gesellschaftsorganisation führen muss – in diesem Punkt war Marx nicht
unutopischer als die anarchistischen DenkerInnen.4
Es ist, da stimmen auch
gestandene MarxistInnen zu, der Vorteil des Anarchismus gegenüber dem
politischen Marxismus, die repressiven Mechanismen des Staates intensiver
herausgearbeitet zu haben. Wenn es eine „Essenz der Anarchie“ auf emotionaler
Ebene gibt, dann ist es die prinzipielle Staatsfeindlichkeit. Allein: Selbst
dieser fehlt jeder theoretische Hintergrund und im Laufe des 20. Jahrhunderts
wurde die Staatsanalyse der AnarchistInnen vom wissenschaftlichen Marxismus
überholt. Die Staatsfeindlichkeit des Anarchismus beruht allein auf
individueller Erfahrung der gewalttätigen Repression, und dies bis heute. Auch
für Horst Stowasser ist der Staat nichts weiter als ein Instrument der
Repression. Wie Bakunin und zahlreiche andere AnarchistInnen bis hin zu
„Autonomen“5
und GlobalisierungskritikerInnen und -gegnerInnen bei G8-Gipfeln in Genua oder
Heiligendamm hat auch der Autor Stowasser den Staat von seiner repressiven Seite
erlebt. Die anarchistische Staatsfeindlichkeit hat immer nur von der Erfahrung
erlebt, wie Horst Stowasser es ausdrückt: vom „Zorn“.
AnarchistInnen können
damit nicht erklären, warum der Staat bis heute global akzeptiert wird. Sie
gehen, wie auch die meisten politischen MarxistInnen, von der
„Repressionshypothese“ aus, sprich: Sie schließen von der Repression, die sie
erlebt haben, auf ein allgemeines System, das nur durch Repression
überlebensfähig ist. Sicherlich sind es polizeiliche Repression, mit Gewalt und
Waffen ausgestattete Staaten, die sich ihre Machtmenge erhalten und diese
erweitern. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wäre das der ganze Staat, so
hätte Horst Stowasser recht, wenn er glaubt, dass die Mehrheit der Menschen aus
„natürlichen“ AnarchistInnen bestände. Und es ist auch nicht so einfach, wie
Degen und Knoblauch diesen Umstand beschreiben: Der Staat hätte typisch
nicht-staatliche Funktionen übernommen – nämlich soziale – und daher gäbe es
keine Sehnsucht mehr nach der antistaatlichen Revolution. Diese Sichtweise
verkennt vollkommen, dass der Staat schon immer eine linke und eine rechte Hand
hatte (Pierre Bourdieu) – dass es z. B. eine Bismarcksche Sozialgesetzgebung gab
– und diese dem Staat auch immanent ist. Des weiteren ist es blanker Hohn, in
Zeiten von Hartz IV das Desinteresse am Anarchismus mit der Zufriedenheit des
Proletariats zu erklären. Dass es bis heute keine fundierte anarchistische
Staatskritik gibt, ist umso verwunderlicher, als dass das Schlagwort der
freiwilligen Knechtschaft von Gustav Landauer durchaus benannt wurde – und von
Michel Foucault dankenswerterweise wieder aufgenommen wurde.
Der Staat ist nicht nur
repressiv, er hat auch eine andere Seite. Er organisiert und kontrolliert. Viele
Menschen sind bereit, um dieser Organisation wegen und ihrer individuellen
Sicherheit die Repression in Kauf zu nehmen. AnarchistInnen müssen sich bewusst
sein, dass ihre Systemalternativen nicht weniger, sondern mehr Arbeit bedeuten,
denn anarchistische Utopien verlagern die zentralen staatlichen Aufgaben auf
eine Gemeinschaftsebene. Möglich, dass die produktive Arbeit im Sinne des
heutigen Kapitalismus auf fünf oder sogar drei Stunden am Tag reduziert werden
kann – die soziale Arbeit wird allerdings einen weit höheren Aufwand nötig
machen. Und – das ist den meisten AnarchistInnen heutzutage unbequem – das gilt
auch für die Themenbereiche Sicherheit und Kontrolle. Eine nicht-staatliche
Gemeinschaft muss diese bisher staatlichen Aufgaben vergesellschaften, um ihrem
Anspruch gerecht zu werden. Sie kann das individuelle wie allgemeine Bedürfnis
nach Sicherheit zumindest nicht ignorieren. Um dieses Thema drücken sich
AnarchistInnen – verständlicherweise – gerne, denn hier tritt eine unangenehme
Wahrheit zu Tage: Konsequenter Anarchismus bedeutet durchaus eine Rücknahme des
Individuums zugunsten der Gemeinschaft.
Give the
Anarchist a Theory... (frei nach
Chumbawamba)
Eine Essenz des
Anarchismus ist somit eine Ethik, die der Volksmund kennt unter dem Sprichwort
„Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu“. Ethik,
die immer problematisch ist, weil sie ohne eine Letztbegründung (wie z. B.
Religion) niemals universalistisch sein kann, sondern immer emotionale und damit
subjektive Argumentation ist, zeichnet den Anarchismus gegenüber dem Marxismus
aus. Dass Anarchismus immer mehr „Gefühl“ ist als der Materialismus, ist seine
große Stärke und seine große Schwäche. Die (voluntaristische) Besinnung auf das
Gefühl – „ich finde etwas falsch“ – macht den Anarchismus in Umsturzsituationen
attraktiver als den verkopften Marxismus. Moral ist eine mächtige Waffe. Es
kommt darauf an, eine ausgewogene Position zwischen menschlicher Emotionalität
und vulkanischer Rationalität zu entwickeln. Der Anarchismus hat durchaus das
Potential dazu.
Sammelbände historischer
anarchistischer Aufsätze sind freilich nicht dazu da, Kritik und Alternativen zu
formulieren, sondern sie dokumentieren einen historischen Stand. Die Aufgabe der
Kritik und Weiterentwicklung liegt bei den LeserInnen – in diesem Sinne ist
gerade die Auswahl von Borries und Weber-Brandies gelungen, denn sie macht die
Leerstellen des anarchistischen Gedankenguts deutlich, auch dank der
kenntnisreichen Kommentare der HerausgeberInnen. Dass Senfts Auswahl hier etwas
magerer daherkommt, liegt zum einen an der beschränkten Seitenzahl (174 Seiten
vs. 424 Seiten), aber auch an dem viel zu eng gefassten Titelthema
„Antiparlamentarismus“.
Mehr erwarten können hätte
man dagegen von der theorie.org-Einführung. Hans Jürgen Degen und Jochen
Knoblauch resümieren zwar über den aktuellen Status des Anarchismus,
diagnostizieren den Anarchosyndikalismus und den Graswurzel-Anarchismus als die
(in Deutschland) noch bestehenden Spielarten und beharren ein weiteres Mal auf
der prinzipiellen Marxismus-Kritik. Zukunftsweisend können die Ausführungen
Degens und Knoblauchs zum einen nicht sein, weil ihre Theoriegeschichte des
Anarchismus mit der Entwicklung eines „Neo-Anarchismus“ rund um die
1968er-Generation endet und weil sie zweitens, dabei diesem
Lifestyle-Anarchismus aufsitzend, ihren Band mit einer komplett falschen
Bestandsaufnahme beenden, nämlich jener, dass der antikapitalistische Kampf
nicht der Kampf der ArbeiterInnenklasse sein könne, „weil sie inexistent ist“
(Seite 197). Mit einer solchen Position erübrigt sich jegliches
antikapitalistische Engagement und damit auch jegliches anarchistische.
Bleibt noch der
„Ziegelstein“ Horst Stowassers. Und in der Tat besitzt „Anarchie!“ ein
Abschlusskapitel „Die Zukunft“. Horst Stowassers praktisches Rezept ist die
Kombination von Tradition und modernem Anarchismus: der Anarchosyndikalismus als
praktische, engagierte Bewegung einerseits und der aus dem 1968er Neoanarchismus
erwachsene und von Stowasser selbst stark geförderte Projektanarchismus
andererseits. Beides ist mehr als plausibel, denn diese beiden Methoden bieten
eine praktische Perspektive über eine Jugendrebellion hinaus. Stowasser ist aber
auch der einzige in unserem kleinen Rezensionskarussell, der auf aktuellere
Theorien des Anarchismus (oder mit diesem verbundenen) eingeht, indem er die
Ansätze des Postanarchismus und des Zapatismus mit einbezieht. In der ersten
Auflage der Einführung Degens und Knoblauchs war der Zapatismus (oder
Neo-Zapatismus, gemeint ist der Aufstand der EZLN seit 1994 in Chiapas/Mexiko)
noch kein Anarchismus, weil er als bewaffnete Guerilla-Bewegung erschien: „Die
neue zapatistische Bewegung ist genuin basisdemokratisch und libertär, ohne
dezidiert anarchistisch zu sein. Dazu ist sie z. B. zu sehr auf ihren ‚Führer’
Marcos zentriert und militaristisch“ (Seite 143).
Es lässt sich in der Tat
trefflich darüber streiten, ob die Zapatist@s anarchistisch seien oder nicht. In
der Neuauflage des theorie.org-Bandes soll dankenswerterweise ein von Jens
Kastner verfasstes Kapitel „Ist der Zapatismus ein Anarchismus?“ eingefügt
werden. Auch Kastner kommt zu dem Ergebnis, dass der Zapatismus kein Anarchismus
sei, da er sich selber eben nicht als solchen benenne. Das angesprochene Problem
ist das der Vereinnahmung durch die, wie Stowasser sie nennt, „wirklichen
AnarchistInnen“. „Natürliche AnarchistInnen“ im Sinne Stowassers wären die
Zapatist@s in jedem Fall, wie vermeintlich „militaristisch“ sie sich auch immer
verhalten. Allerdings sind Degen und Knoblauch auch damit einem Irrtum
verfallen, denn anders, als sie betonen, schwebt der Bundesstaat Chiapas/Mexiko
keineswegs „zwischen der Repression der Armee und den EZLN-Guerilla-Aktionen“
(ebd.). Der erste Teil der Aussage ist noch korrekt, das zapatistische
Engagement aber besteht keineswegs in einem bewaffneten Kampf, sondern im Aufbau
kollektiver Gegenstrukturen weit über die Grenzen des Bundesstaates hinaus.
Es ist andererseits müßig,
darüber zu debattieren, ob der Zapatismus ein Anarchismus ist oder nicht.
Wichtig am Aufstand der EZLN in Chiapas ist vielmehr, dass es sich um einen
bisher erfolgreichen Aufstand mit der Etablierung kollektiver Gegenstrukturen
handelt. Der bisherige Erfolg der EZLN stellt die Spanische Revolution insofern
in den Schatten, als dass er auf eine mittlerweile 13jährige basisdemokratische
Selbstverwaltung verweisen kann. Wenn der Anarchismus jemals einen theoretischen
Vorteil gegenüber dem politischen Marxismus hatte, dann den, dass er sich aus
der praktischen Bewegung entwickelte. Relevant ist nicht, wie die Zapatist@s
sich nennen, sondern relevant ist, was die AnarchistInnen von ihnen lernen
können. Und das ist einiges, etwa das Prinzip, sich nach den Langsamsten zu
richten, die „vielen Welten“ (nennen wir es Toleranz oder, mit den Worten eines
Genossen, „eingeschränkten Pluralismus“) und, vor allen Dingen: das Prinzip des
fragenden Voranschreitens. Es gibt keine fertigen Antworten bei Bakunin,
Kropotkin oder sonst jemandem, sondern die neue Welt muss täglich neu erfunden
werden.
Zugegeben: Das alles ist
den anarchistischen Ideen eigentlich nicht neu, aber teilweise durch Dogmatismus
in Vergessenheit geraten, teilweise seit langem nicht praktisch ausprobiert
worden. Und dass die Theorieproduktion aus der Praxis heraus gewinnbringend ist,
zeigt das Beispiel der EZLN selbst: Diese ist 1984 als stramm
maoistisch-guevaristische Guerilla in den Lakandonischen Urwald gezogen, um 1994
als Guerilla ganz neuen Typus aufzutreten.6
Neben Subcomandante Marcos ist einer der interessantesten Theoretiker des
Zapatismus der aus dem offenen Marxismus kommende John Holloway. Breit rezipiert
wurde auch hierzulande sein Buch „Die Welt verändern ohne die Macht zu
übernehmen“ (Münster 2004), das schon durch seinen Titel die Nähe zum
Anarchismus beweist.7
Holloways theoretische Interventionen sind der beste Beweis dafür, wie man durch
praktische Bewegungen zu einer Theorie kommen kann – und nur so kann
anarchistische Theoriebildung funktionieren. Auch wenn diesbezüglich der Praxis
(und zwar nicht jener der „wirklichen AnarchistInnen“, sondern jener der
Widerständigen im allgemeinen, die oftmals keineswegs auch nur „natürliche
AnarchistInnen“ sind) ganz im Sinne Horst Stowassers der Vorrang gebührt, ist
allgemein doch eine Theorieabstinenz oder sogar -feindlichkeit in
anarchistischen Kreisen zu kritisieren, und diese basiert häufig auf Vorurteilen
und Dogmen, die ich in dieser „Rezension“ bereits benannt habe.
Die relevanten Desiderata
des Anarchismus sind Ökonomie und Staatskritik, auch die Gründe dafür habe ich
benannt. Ein ernstzunehmender Anarchismus heute muss sich, um die ökonomischen
Desiderata zu überwinden, mit der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigen,
mit Marx also und mit jenen offenen MarxistInnen verschiedener Schulen, die die
Kritik der politischen Ökonomie anhand des veränderten Kapitalismus weiter
entwickelt haben. Als Anarchist muss mensch unumwunden zugeben, dass die
MarxistInnen immer die bessere Wirtschaftsanalyse hatten.8
Die Staatskritik des
Anarchismus – seine vermeintliche Stärke – ist, wie erwähnt, eigentlich sogar
noch desolater als die Kritik der politischen Ökonomie. Hier sind es in der Tat
die TheoretikerInnen der so genannten Postmoderne, auf die zu rekurrieren wäre.
Das Problem anarchistischer Staatskritik ist, dass sie für die meisten Menschen
abstrakt bleibt, sie erscheint als eine Sammlung von Extrembeispielen, die die
„Zivilgesellschaft“ so nicht erfahren hat (die meisten BürgerInnen und auch die
meisten ProletarierInnen werden heutzutage eher selten von Polizisten verprügelt
...). Die postmodernen TheoretikerInnen dagegen greifen in ihren Studien Themen
der Regierung und des Staates auf, die im Alltag erfassbar sind – wobei nicht zu
unterschätzen ist, dass diese Mechanismen zu einem großen Teil gar nicht als
störend empfunden werden. Diesbezüglich sind gerade die
Gouvernementalitätsstudien Michel Foucaults für anarchistische Theorieproduktion
unumgänglich, denn Foucault bietet unter anderem einen Ansatz dafür, die
neoliberalen Formen der „Selbstregierung“ zu erklären. Poststrukturalistische
TheoretikerInnen mögen nicht unbedingt AnarchistInnen sein, aber die
Fragestellungen sind sich sehr ähnlich: Warum, um Himmels willen, lassen
Menschen sich freiwillig regieren? Auch der offene Marxismus hat hier Antworten
parat, die den Theorien des Poststrukturalismus entsprechen: Der Staat ist nicht
(nur) ein institutioneller „Überbau“, sondern er ist – ähnlich wie das
Klassenverhältnis – ein Verhältnis, dass durch unsere Köpfe und Herzen geht.
Als letztes ist unbedingt
auf den Operaismus hinzuweisen: Der „Arbeiterismus“, wie er frei übersetzt
heißen würde, ist eigentlich nahezu identisch mit den Ideen des
Anarchosyndikalismus, nur dass er längerfristige und größere Organisationen als
Bedrohung einer ArbeiterInnenautonomie empfindet (was teilweise verständlich
ist, teilweise aber auch zu einer bedrohlichen Organisationsfeindlichkeit
geführt hat) und zweitens der anarchistischen Ideologie nicht bedarf – wie es
etwa auch bei der syndikalistischen Gewerkschaft IWW (Industrial Workers of the
World) der Fall war und ist. Die Klassenfragmentierung, die die Autoren
Degen/Knoblauch so sichtbar irritiert, dass sie die ArbeiterInnenklasse für
nicht mehr existent halten, erklärt der Operaismus mit dem Begriff der
Klassenzusammensetzung, die eben wandelbar ist oder in Marx’ Worten, die
Gesellschaft (das heißt die Klassenzusammensetzung) ist eben kein fester
Kristall (MEW 23). Der Operaismus ist fähig, durch einen Erfahrungsansatz
gesellschaftsverändernde Prozesse zu analysieren, indem er im wahrsten Sinne des
Wortes „fragend voranschreitet“, durch radikale ArbeiterInnenbefragungen. Für
einen Anarchismus, der sowohl revolutionär als auch reformistisch ist (da er die
Veränderungen nicht in irgendeine utopische Zukunft verlegt10),
ist ein solcher Erfahrungsaustausch unerlässlich.
Allerdings nicht in der
Form, wie er von Martin Birkner und Robert Foltin beschrieben wird11
und nicht in der Form des aus dem Ruder gelaufenen Postoperaismus von Hardt und
Negri. Birkner und Foltin beschreiben den Operaismus so, als sei er die
intellektuelle Idee einiger revolutionärer Studierender und
Parteiintellektueller gewesen, die in die Fabriken gegangen sind – das war er
auch, aber er hätte keine Bedeutung, wenn er nicht eine Bewegung in den
Fabriken gewesen wäre. Nur mit dieser intellektuellen Einstellung kann man zu
der Position gelangen, der so genannte „Postoperaismus“ sei die konsequente
Weiterentwicklung des operaistischen Denkens.
Negri und Hardt sind das
beste Beispiel für einen linken Theoretizismus, der den Kontakt zur Basis
eigentlich verloren hat. Daran ändern auch die aktivistischen Tute Bianche
(„Weiße Arbeitsanzüge/Overalls“) oder Disobbedienti (die Ungehorsamen) nichts,
denn sie haben ihre (lobenswerte) Praxis einer am Schreibtisch entstandenen
Theorie untergeordnet, die dem Linksradikalismus genehm war, anstatt aus der
alltäglichen Praxis eine adäquate Theorie zu entwickeln. Das Problem Negris ist,
immer noch nach dem kollektiven revolutionären Subjekt zu suchen und zwar in dem
überkommenen Sinne eines bewussten Subjekts, das die Revolution machen will. Da
er es in der Arbeiterklasse nicht (mehr) finden konnte, fand er es erst in den
„gesellschaftlichen ArbeiterInnen“ und später gemeinsam mit Michael Hardt in der
„Multitude“ – auch wenn dies die „Vielheit der Widerstände“ ist. Hardt und Negri
geben sich postmodern und versuchen dennoch etwas, was mit postmoderner Theorie
eigentlich nicht möglich ist: Eine große Erzählung mit einem revolutionären
Subjekt, das zwar hybrid ist, aber ein gemeinsames Ziel haben soll. Wie einige
linke Gruppen sich als neues Subjekt das „Prekariat“ erfunden haben, so die
beiden Theoretiker die heterogene „Multitude“. Das Konzept fand Anklang, weil es
so einfach war, sich damit zu identifizieren: Jeder, der dagegen ist, gehört
dazu und ist damit revolutionäres Subjekt.12
Der Begriff der Multitude hat nur einen Vorteil. Er ist ein Gegenbegriff zum
nationalistischen „Volk“, der besagt: Wir sind alle verschieden.
Über das voluntaristische
„Wir gegen die“ (oder „Multitude gegen Empire“) sollten die Anarchismen aber
längst hinaus sein. Zwar ist der Voluntarismus nach wie vor wichtig und
notwendig für den Anarchismus („Es wird keine Revolution geben, bevor die
Menschen nicht einverstanden sind“), aber die eigentliche Frage ist nicht mehr
„Wer will?“ sondern „Wer kann denn überhaupt?“ Der Zweck heiligt weder die
Mittel, noch geht es um eine Übereinstimmung von Mittel und Zweck, sondern „der
Weg ist das Ziel“ – die Mittel erst bestimmen den Zweck, die Art, Fragen zu
stellen, impliziert die Antworten.
Der Haken am „Postoperaismus“
ist die Unterschätzung der ökonomischen und strukturellen ArbeiterInnenmacht:
Auch die „Multitude“ – die als Ziel erstrebenswert ist – hat nur dann die
Möglichkeit zur sozialen Revolution, wenn sie in ihrer Rolle als Proletariat
agiert, denn nur in dieser Rolle hat sie produktive Macht (und das „Prekariat“
ist entsprechend höchstens als der Teil des Proletariats zu verstehen, der wenig
von dieser strukturellen Macht hat). Als „Multitude“ sind sie nur die berühmte
„Zivilgesellschaft“, die in einen „fordernden und fördernden“, aber keinesfalls
radikal gesellschaftsverändernden, Dialog mit den Herrschenden treten kann. Die
Konsequenz Negris und Hardts passt dazu: Ihre politischen Forderungen nach einer
WeltbürgerInnenschaft und einem garantierten Grundeinkommen, die beide sinnvoll
sind, lassen sich nur im politischen Dialog erreichen, nicht aber durch direkte
eigene Aktionen einfach machen (was die Hollowaysche kreative Macht [power-to-do]
wäre). Systemimmanent sind diese Forderungen durchaus sinnvoll, aber sie bleiben
halt Forderungen, die an Herrschende gestellt werden müssen. Dem Operaismus –
wie auch dem Anarchosyndikalismus – entspricht diese Strategie nicht.
Abgesehen von Horst
Stowasser, der den Blick in die Zukunft wagt, ist dieser aktuelle Wandel
anarchistischer Theorien (im wesentlichen kein Wandel, sondern eine
Pluralisierung) in den neusten Bänden zum Thema „Anarchismus“ nicht
thematisiert. Es wird höchste Zeit, dass die heutigen AnarchistInnen die
entsprechenden Fragen stellen und eine entsprechende Theorieproduktion
betreiben. Ansonsten befördert er sich selbst dahin, wo Lenin in einst
hinwünschte: auf den Müllhaufen der Geschichte.13
Die relevanten Stichworte kommen aus dem Marxismus, der sich dankenswerterweise,
zumindest soweit er noch irgendeine Relevanz hat, geöffnet hat: Jeder sinnige
Marxismus hat heutzutage Grundgedanken des Anarchismus aufgenommen. Es ist an
der Zeit, dass der Anarchismus das seinige tut und einen „open anarchism“ (er)findet,
der in einen konstruktiven Dialog mündet. Mit John Holloway sollten wir den
Parteimarxismus belächeln und die historisch konstruierte Barriere zwischen
Anarchismus und Marxismus zukünftig ignorieren. Tendenziell unterscheiden sich
die (begrenzt) pluralistischen Anarchismen und Marxismen dann nicht mehr.
Was der Papierproduktion
des Anarchismus momentan gelingt, ist dem offenen Marxismus nur zu wünschen.
Denn letztendlich sind wir in der historischen Situation, in der Marx und
Bakunin endlich ihren Frieden finden könnten. Die Zwistigkeiten zwischen den
verfeindeten Zwillingsbrüdern Anarchismus und Marxismus sind – auch Dank dem
Ende des vermeintlich „real existierenden Sozialismus“ – obsolet. Das angebliche
„Ende der Geschichte“ bietet die – zeitverzögerte – Chance eines gemeinsamen
Neuanfangs. In einem Punkt haben Michael Hardt und Antonio Negri recht: Zum
ersten Mal besteht die Möglichkeit des Kommunismus (aber eben nur die
Möglichkeit); nicht nur, weil der globalisierte Kapitalismus an seine Grenzen
stößt, sondern auch, weil die ApologetInnen des Kommunismus auf einen Nenner
kommen können. Das ist kein Glück, sondern harte Arbeit. Aber das war der
Kommunismus schon immer.
E-Mail: torsten.bewernitz@uni-muenster.de
„Rezensierte“ Literatur:
Borries, Achim von und Ingeborg Weber-Brandies
(Hrsg.): Anarchismus. Theorie, Kritik, Utopie. Verlag Graswurzelrevolution,
Nettersheim 2007. 22,80 Euro.
Degen, Hans-Jürgen und Jochen Knoblauch:
Anarchismus. Eine Einführung, Schmetterling Verlag, Stuttgart 2006, 10 Euro.
Senft Gerhard (Hrsg.): Essenz der Anarchie. Die
Parlamentarismuskritik des libertären Sozialismus. Promedia, Wien 2006. 12,90
Euro.
Stowasser, Horst: Anarchie! Idee - Geschichte -
Perspektiven, Edition Nautilus, Hamburg 2007. 39,80 Euro.
1 z.B. Stalin, Josef:
Anarchismus oder Sozialismus. Berlin 1951.
2 Pop, Paul:
Rot-schwarze Flitterwochen, Marx und Kropotkin
für das 21. Jahrhundert. Moers 2006.
3 Drücke, Bernd: Libertäre
Parlamentarismuskritik. Essenz der Anarchie? In: Graswurzelrevolution
312, Oktober 2006 (Beilage „Libertäre Buchseiten“).
4 Vgl. dazu meinen Beitrag
„Klasse[n] von Gewicht. Probleme des Klassenkampfes in der Postmoderne.“
In Mümken, Jürgen: Anarchismus in der Postmoderne. Beiträge zur
anarchistischen Theorie und Praxis. Lich 2005. S. 63–92.
5 Ich verwende den Begriff
der „Autonomen“ in Anführungsstrichen, weil insbesondere im
deutschsprachigen Bereich damit schwarz vermummte Lifestyle-Linke
assoziiert werden. Der Begriff entstammt der italienischen „Autonomia
Operaia“, deren VertreterInnen heute als „OperaistInnen“ bekannt sind.
Die Autonomen der 1980er Jahre hatten damit schlichtweg nichts mehr zu
tun. Im Gegenteil wurden die ArbeiterInnen, die das Potential gehabt
haben könnten, sich selbst zu verwalten, zum prinzipiellen Gegner, da
ihr Lifestyle als „spießig“ empfunden wurde.
6 Subcomandante Marcos
erzählt diesen Prozess gleichnishaft (und kurzweilig) in den
„Geschichten vom alten Antonio“, die der Verlag Assoziation A 2006 neu
aufgelegt hat.
7 Als kürzere Einführung
empfiehlt sich: Holloway, John: Die zwei Zeiten der Revolution. Würde,
Macht und die Politik der Zapatistas. Übersetzt u. eingeleitet von Jens
Kastner. Wien 2006.
8 Wobei das in der Praxis
nur eingeschränkt gilt: Interessanterweise waren durch ihre
Staatsablehnung die AnarchistInnen immer diejenigen, die konsequent
einen ökonomischen Kampf einforderten anstatt eines politischen – die
Praxis der Anarchismen (insbesondere des Anarchosyndikalismus) ist viel
näher an Marx als die Praxis der politischen MarxistInnen. Für das
Verständnis von Klasse – abgesehen von den OperaistInnen – gilt
ähnliches. Die Ablehnung Marx’scher Theorie ist ein modernes Phänomen
des „Neo-Anarchismus“. Die historische Ablehnung eines Marxismus durch
AnarchistInnen betraf den politischen Marxismus, den auch Karl Marx
selber bekanntlich kommentierte mit: „Wenn das Marxismus ist, bin ich
kein Marxist“. Die Re-Lektüre der anarchistischen „Klassiker“, die
gerade mit dem Band des Graswurzelverlags schön nachzuvollziehen ist,
verdeutlicht das.
10 Rosa Luxemburg hat als
erste darauf hingewiesen, dass der vermeintliche Widerspruch Reformismus
– Revolution so bei Marx nicht zu finden ist. Eine Bewegung für soziale
Gerechtigkeit muss immer beide Funktionen erfüllen, was sie zwar
einerseits in Widersprüche verstrickt, aber andererseits wäre sie ohne
beide Aspekte unglaubwürdig. In den Worten der FAU-Ortsgruppe Hamburg:
„Egal ob soziale Revolution oder fünf Minuten Pause – der Kampf ist
derselbe!“
11 Vgl. Birkner, Martin und
Robert Foltin: (Post)Operaismus. Von der Arbeiterautonomie zur
Multitude. Geschichte und Gegenwart, Theorie und Praxis. Stuttgart 2006.
(Reihe theorie.org).
12 In der Debatte um Karl
Heinz Roths Text „Die Wiederkehr der Proletarität“ wurde eine ähnliche
Kritik laut. Roth hätte einfach alle „Linken“ ins Proletariat
vereinnahmt und sie so wieder zum „revolutionären Subjekt“ gemacht. Vgl.
Roth (Hrsg.): Die Wiederkehr der Proletarität. Dokumentation einer
Debatte. Stuttgart 1994. Diesen zugestandenen Fehler vermeiden Hardt und
Negri. Während Roth den Linken (jenen, die „wollen“), eine Rückkehr zu
jenen, die „können“ (dem Proletariat), zubilligt, definieren Hardt und
Negri nur diejenigen, die „wollen“, ohne ökonomische Grundlage, als
heterogenes revolutionäres Subjekt. Vgl. zu dem Unterschied zwischen
einem Möglichkeits-, Notwendigkeits- und einem Verelendungskriterium
Fußnote 4.
13 Klugscheißerfußnote:
Lenin sagte erstens nicht Anarchismus, sondern Linksradikalismus; und
zweitens wünschte er ihn nicht dahin, sondern meinte, er sei schon da.
|
