|

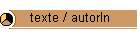

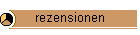



| |
Ebru Işikli:Die
Massenmigration in der Türkei der 1950er-Jahre vom Land in die Städte
Übersetzt von Käthe Knittler und Francois Naetar
Einleitung
Türkische
IndustriearbeiterInnen kamen in den 1950er-Jahren hauptsächlich aus ländlichen
Gebieten der Türkei in die Städte. Das ökonomische Umfeld dieser Jahre ist schon
genau untersucht; ich versuche dagegen in diesem Artikel herauszufinden, wie die
IndustriearbeiterInnen diese Zeit erlebten. Die 50er-Jahre in der Türkei hatten
einige Besonderheiten bezüglich der Arbeitsbedingungen. Insgesamt gesehen, hat
die Migration viele verschiedene Aspekte, wie Urbanisierung, demographische
Änderungen, usw. In diesem Artikel wird nur der Aspekt der Arbeitsbedingungen
behandelt.
Verschiedene
Blickwinkel, die Geschichte von Arbeits- und Klassenbeziehungen zu betrachten
Methodisch möchte dieser
Artikel die strukturellen Änderungen der Arbeitsbeziehungen im Kontext der
täglichen Erfahrungen der ArbeiterInnen behandeln.
In den Untersuchungen über die Geschichte der Arbeit können verschiedene, zum
Teil in Widerspruch zueinander stehende, Herangehensweisen festgestellt werden.
Auf der einen Seite wurden - vornehmlich in den 50er-Jahren in Europa - die in
den Gewerkschaften und politischen Parteien organisierten ArbeiterInnen
betrachtet. Änderungen der Klassenverhältnisse wurden durch Verschiebungen in
ökonomischen und politischen Verhältnissen erklärt. Die ArbeiterInnenklasse war
ein abstraktes Strukturkonzept.
In den späten Sechzigern
entwickelte sich im Zusammenhang mit der Stärkung der politischen Bewegungen und
dem verstärkten politischen Engagement der Forscher ein gesteigertes Interesse
an der Alltagskultur und dem Alltagsleben der ArbeiterInnen. Eley schreibt: „
Das Alltagsleben ist Brennpunkt der revolutionären Widersprüche in einer Welt
entfremdeter Sozialbeziehungen“ (Eley, 1989) Die Hauptaufgabe der
ArbeiterInnenforschung bestand in der Suche nach einem geschichtsmächtigen
Subjekt in seinen Existenzbedingungen. Das Interesse der Forscher verschob sich
von der Geschichte der Klassen (der Klassenanalyse) zur Geschichte der
Klassenkämpfe. Andere Fachrichtungen wie Soziologie und Psychologie wurden in
die Untersuchungen miteinbezogen, um die Entwicklungen der Alltagskultur und des
Alltagslebens zu verstehen. Das Erwachen der Klassenkräfte in den Kämpfen selbst
wurde interessant.
In der Suche nach
geeigneten Theorien war Thompson am einflussreichsten. E.P. Thompson beschrieb
die Entstehung der ArbeiterInnenklasse mehr als einen Prozess der
Selbstermächtigung[1]
denn als ein Fortschreiten der Geschichte zu einem vorbestimmten Ende. Das stand
im Widerspruch zu der marxistischen Tradition, die Klassenentstehung aus der
Entwicklung der Produktivkräfte zu erklären. Die Thompsonsche Beschreibung des
Klassenbildungsprozesses war durch die Erfahrungen der an ihm teilhabenden
Menschen geformt.
Die Betrachtung des
Alltags hatte in dieser Theorie eine wichtige Bedeutung und führte dazu, dass
sich viele Forscher mehr mit dem Alltag der ArbeiterInnen als mit den
Gewerkschaften und politischen Parteien zu beschäftigen begannen. E.P. Thompson
wiederum wurde einerseits vorgehalten, dass er einen marxistischen,
vordeterminierten ArbeiterInnenklassenbegriff während seiner Archivforschungen
im Kopf habe, trotz seiner Behauptung, dass die Erfahrung hier sich selbst
darstelle. Andererseits wurde ihm vorgehalten, dass er die Erfahrungen der
ArbeiterInnen und nicht deren Beziehungen zu den Produktionsmitteln ins Zentrum
stelle[2].
Thompson empfiehlt einen
gewissen Skeptizismus[3]
und ein Relativieren starrer Modelle bei Forschungen, wenn der
Untersuchungsgegenstand für eine dialektische Herangehensweise geeignet ist. Die
dialektische Methodik besteht ja darin, durch das Aufspüren der immanenten
Widersprüche einer bestimmten Argumentation zu einer vertieften Argumentation
mit verbesserter Erklärungskraft zu gelangen. In diesem Sinn ist die Stärke des
Thompson’schen Ansatzes die Verbindung von Erfahrung mit Struktur. Das
Schlüsselwort für Thompson ist Erfahrung – die Erfahrung der ArbeiterInnen
sollen in die Untersuchungen eingehen. Nicht mehr nur den Arbeitsplatz, sondern
auch das Leben abseits des Arbeitsplatzes soll in die Untersuchungen einfließen.
Thompson ist skeptisch
bezüglich linearer Konzeptionen von Geschichte und weist darauf hin, dass
Konzepte durch Erfahrungen an Realität gewinnen. In seinen diesbezüglichen
Studien verwendet er den Begriff der „moral economy“
[4],
um sich auf die wirkmächtigen, aber nicht oder nur ungenügend in Gesetzen
niedergelegten informellen Regeln der Subalternen zu beziehen.
Yiğit Akın kritisiert in
Übereinstimmung mit diesen Überlegungen das Fehlen von Studien über die Sozial-
und Kulturgeschichte der Arbeit. Auch Hakan Koçak kritisiert eine Forschung,
welche die offiziellen Regelungen der Arbeitsbedingungen als Ausgangspunkt ihrer
Geschichtsschreibung nimmt. Er unterscheidet zwei Ansätze. Der erste
interessiert sich für Verhältnisse der industriellen Arbeit, der andere für
Klassen. Ersterer liefert eine Aufzählung von Änderungen in den
Arbeitsbeziehungen[5],
letzterer kann eine Vorstellung über Konflikte und Interaktion zwischen den
Klassen liefern.
Im Sinne dieser Betrachtungen werden in diesem
Artikel Erfahrungen mit strukturellen Veränderungen verbunden. Unter
Berücksichtigung des Kontextes wird den Erfahrungen der Menschen mittels der
Erinnerungen der interviewten ArbeiterInnen selbst auf den Grund gegangen.
Obwohl es aufgrund des hohen Alters der Zielgruppe schwierig war, ArbeiterInnen
zu finden, die in den 50er-Jahren in den Arbeitsprozess eingetreten waren,
konnten drei Ex-Arbeiter dieser Zielgruppe interviewt werden. Es sind:
Celal Potur (1931), Et Balık Kurumu-1952
(arbeitete 25 Jahre), migrierte 1955 von Giresun nach İstanbul,
Vasfi Işıklı (1931), Derby Shoes-1940
(arbeitete 26 Jahre), migrierte 1955 von Yozgat nach İstanbul,
Mehmet Özgün (1924), Akfil Textile-1955
(arbeitete 14 Jahre), migrierte 1956 von Trabzon nach İstanbul.
Kontext
Die Veränderungen
kapitalistischer Gesellschaften in den 1950er-Jahren beeinflusste die
Arbeitsverhältnisse und Bedingungen sowie andere Gegebenheiten des Staates in
der Türkei. Die Zeichen der Zeit waren: Industrieentwicklung durch eine
liberale, aber auch geplante Wirtschaft in Verbindung mit einem
Mehrparteiensystem. Die vorherrschende „solidarische“ Ideologie des
Einparteienregimes verlor ihren Einfluss, der autoritäre Charakter des Staates
wurde durch die marktwirtschaftlichen Reformen herausgefordert, die Türkei
näherte sich den USA und ihrer Ideologie an, um sich besser in die
Weltwirtschaft zu integrieren.
Nach 1954 wurden aber
Importbeschränkungen eingeführt, die der lokalen Bourgeoisie mehr Kapital zu
akkumulieren gestattete. Die Marktwirtschaft verwandelte sich durch den Schutz
des Heimmarktes in eine gemischte Wirtschaftsform. Topraks Periodisierung der
türkischen Wirtschaftsformen liefert folgendes Bild der 50er-Jahre[6]:
-
Periode der Liberalisierung: 1948-1953
-
Gemischte Wirtschaft: 1954-1957
-
Ökonomische Stabilisierung: 1958-1962
Die Demokratische Partei (DP) wollte
den einzelnen ArbeiterInnen mehr individuelle Rechte (arbeitsfreie Tage,
bezahlten Urlaub, etc.) als die CHP (Republikanische Volkspartei) zugestehen.
Dabei wollte sie verhindern, dass diese sich in Klassenorganisationen
zusammenschlössen. Gemeinsam war beiden Parteien, dass sie den Klassenkonflikt
schlichtweg leugneten[7].
Beschränkungen für Klassenorganisationen wurden 1946 abgeschafft, und das
Gewerkschaftsgesetz 1947 verabschiedet; aber Streiks waren weiterhin verboten.
Man versuchte, Klassenkonflikte auf individueller Basis zu behandeln, und
ähnlich den USA Organisationen der ArbeiterInnenklasse frei von Politik zu
halten[8].
Makal meint, dass die DP der ArbeiterInnenklasse näher gestanden habe, da sie
das Recht auf Streiks und eine unterschiedliche Behandlung von Streiks und
Aussperrungen einzuführen versprach. Allerdings änderte sich diese Haltung der
DP Ende der 50er-Jahre. Sie sprach nicht mehr über demokratische Rechte und
hörte auf, das Recht auf Streiks zu verteidigen[9].
Die CHP ihrerseits änderte ihre Haltung zu den ArbeiterInnenorganisationen, die
ausgehend von „Arbeiterbüros“ in der Zeit der Mehrparteienkonkurrenz (1948)
entstanden. Die 50er-Jahre kennzeichnete eine Zunahme von Betrieben, die Kredite
der „Industrial Development Bank“ erhielten und fordistische Produktionsformen
einzuführen begannen. Dadurch gewannen die IndustriearbeiterInnen mehr und mehr
an Bedeutung, obwohl sie noch keinen bedeutenden Teil der ArbeiterInnenschaft
darstellten[10].
Keyder meint, dass so gut wie jeder Betrieb in den 50ern-Kredit von der
„Industrial Development Bank“ erhalten habe[11].
Er meint auch, dass die 50er-Jahre für die Entstehung einer Abeiterbewegung
jenseits der CHP bedeutend gewesen seien[12].
Arbeitsverhältnisse
während der 50er Jahre
Die Geschichte der
ArbeiterInnenbewegung begann nicht 1950. Aber die 50er-Jahre zeichneten sich -
bedingt durch die oben beschriebenen internen und internationalen Entwicklungen
– durch einige Besonderheiten in Bezug auf die Entwicklung der
Arbeitsverhältnisse aus. Aber auch was vorher geschah, hatte eine Einfluss. Die
Kriegswirtschaft des 2. Weltkriegs schränkte bestimmte Formen von Zwangsarbeit
(bounded labour) mit der damit einhergehenden Ausbeutung von Kindern und Frauen
ein.
Die in der Zeit des
Einparteiensystems vorherrschende Ideologie der so genannten Solidarität
war nichts anderes als staatlicher Dirigismus, der die Klassenbasis der
Gesellschaft verleugnete, um die Einheit der Nation in den Vordergrund zu
stellen[13].
Die Ideologie der Solidarität meinte, wenn alle für die Entwicklung der
Gesellschaft ohne Konflikte und Kämpfe zusammenstünden, würde sich auch die
Nation entwickeln. Das bedeutete, dass die gewerkschaftliche Organisation der
ArbeiterInnen behindert werden sollte. Gewerkschaften mit wenig Rechten
(Streikverbot) konnten nicht einmal die den ArbeiterInnen zustehenden
gesetzlichen Rechte durchsetzen, geschweige denn die informellen Gesetze, die in
einer von LandarbeiterInnen dominierten Gesellschaft vorherrschten. Wie gesagt:
Obwohl die Anzahl der IndustriearbeiterInnen insbesondere in den großen Städten
zunahm, waren sie nur ein kleiner Teil der ArbeiterInnenschaft.
Die Zeiten änderten sich
schnell. Nach dem Krieg beschleunigte der Kapitalismus seine Entwicklung. Der
Marshall-Plan, der den Ländern, die am 2. Weltkrieg teilgenommen hatten, Hilfe
und die Integration ins kapitalistische Weltsystem versprach, beeinflusste auch
die Wirtschaftspolitik der 50er-Jahre. Die politischen Veränderungen führten zum
Mehrparteiensystem. Zusammen mit der Einführung von Wahlen verlor die Ideologie
der Solidarität an Einfluss, Liberalismus und Planung traten in den
Vordergrund (in Übereinstimmung mit den Erwartungen der Hegemonialmacht USA).
Die Mechanisierung der Landwirtschaft war eines der Resultate dieser
Nachkriegsperiode.
Nicht allein der
durch die Mechanisierung der Landwirtschaft bewirkte Arbeitskräfteüberschuss,
auch der Versuch, der Armut am Land zu entkommen, zwang BäuerInnen in die Städte
zu wandern, um dort Arbeit zu finden. Im Osten der Türkei eher als im Westen
zwangen auch Enclosures
[14]
zur Migration. Die Steigerung der Agrarproduktion infolge der Mechanisierung
führte zu einem generellen Anstieg der kommerziellen Aktivitäten, der Export
nahm um 50% zu, die Anzahl der Fabriken stieg genauso wie die Anzahl der
ArbeiterInnen in den Fabriken; in der zweiten Hälfte der 50er-Jahre erhöhte sich
die Anzahl der Fabriken von 163.000 auf 324.000[15].
Der Anteil der StadtbewohnerInnen an der Gesamtbevölkerung stieg von 19% auf 26%[16].
Während also die Anzahl der IndustriearbeiterInnen stieg, verringerte sich die
bäurische Bevölkerung auf dem Land durch die Migration in die Städte[17].
Die
Arbeitsmöglichkeiten, die sich entweder durch die Industrie in den Städten oder
durch Bau- und Infrastrukturprojekte im ganzen Land auftaten, verhießen den
BäuerInnen ein besseres Leben. Die Leute, die aus den Dörfern auswanderten,
waren billige Arbeitskräfte für die Industrie. Unmissverständlich stellen
AkteurInnen dieser Auswanderungswelle fest, Stadtbewohner wären nicht bereit
gewesen, zu den Bedingungen zu arbeiten, zu denen sie arbeiteten. Es stellt sich
die Frage, wie groß der Anteil der in der Stadt aufgewachsenen ArbeiterInnen
war.
Die
MigrantInnen waren hauptsächlich Männer. Die Trennung von ihren Dörfern und die
schwierigen Lebensbedingungen in einer ihnen völlig unbekannten Umgebung führte
entweder dazu, die alten Beziehungen zum Dorf zu bewahren, oder sich neue Netze
aufzubauen, die es ihnen gestatten sollten, die Erwartungen, die sie an die
Stadt hatten, umzusetzen. Alles schien in der Stadt besser als im Dorf zu sein.
Sie dachten keinesfalls daran, in ihre Dörfer zurückzukehren, nachdem sie sich
etwas Geld erspart hatten, im Gegenteil: Sie arbeiteten noch härter, um ihre
Familien ebenfalls in die Stadt zu bringen und sich dort um sie zu kümmern – vor
allem wenn sie Erwachsene waren. Nicht-wirtschaftliche Faktoren zu der sie
umgebenden Gesellschaft spielten eine wichtige Rolle in ihren Leben, das durch
den Überlebenskampf in einer Marktgesellschaft gezeichnet war. Die Anonymität
der Beziehungen einer modernen Gesellschaft mussten sie erst mühsam lernen; oder
sie hatten schon einige Erfahrungen durch den für Männer verpflichtenden
Militärdienst. Das Leben in einer modernen Gesellschaft erfordert idealer Weise
Vertrauen in die Institutionen und Beziehungen zwischen anonymen Individuen[18].
Menschen, die kein Vertrauen in diese Art von Beziehungen haben, sind denjenigen
gegenüber benachteiligt, die dieses Vertrauen durch Erziehung und Praxis
besitzen. Ihre Möglichkeiten zu Veränderungen sind weniger entwickelt. Sie
ziehen informelle Beziehungen zu Personen vor, in die sie Vertrauen gewinnen
können. Es muss betont werden, dass an dieser Unfähigkeit Organisationen schuld
sind, die Möglichkeiten für die soziale Integration in die Gesellschaft hätten
bieten sollen[19].
Die Menschen,
die wegen extremer Armut ihre Dörfer verließen, entwickelten allein oder
kollektiv Techniken, um ihr Leben in unbekannter Umgebung zu organisieren. Diese
halfen, ein nicht vollständig „freier Arbeiter“
[20]
zu sein, und verminderten die Gefahr, vollständig die Kontrolle über ihre Leben
zu verlieren. Die Bedingungen der ersten Stadtjahre machten sie zu einer Art von
„Kriegern“, und ihre persönlichen Bemühungen lösten so manches Problem, für
dessen Lösung öffentliche Stellen verantwortlich gewesen wären[21].
Aufbruch in die
hoffnungsfrohe Ungewissheit
Die Arbeitsmigration vom Land in die
Stadt war männlich dominiert. Startpunkt für das neue Leben in der Stadt waren
zumeist irreguläre Arbeiten, wie beispielsweise im Baugewerbe. Oft teilten die
jungen Männer ein Zimmer, und es war üblich, mehr als nur einen Job zu haben, um
schnell so viel Geld wie möglich zu verdienen. Nach der ersten Zeit der
Eingewöhnung und gewissen Ersparnissen holten viele ihre Familien vom Land nach,
um sich und ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen, auch weil sich die
Lebensbedingungen auf dem Land mit Einführung der Kriegswirtschaft[22]
deutlich verschlechtert hatten.
Ein Arbeitsplatz in der
Fabrik war begehrt, aber es war nicht einfach, einen zu bekommen, da man dazu
meist Empfehlungen brauchte. Ein regulärer, wenn auch ein unqualifizierter,
Arbeitsplatz stellte eine deutliche Verbesserung gegenüber temporären
Beschäftigungsmöglichkeiten dar. Die Frage nach qualifizierter Arbeit stellte
sich für viele erst gar nicht, bzw. schien es beinahe unmöglich, eine solche
anstreben zu wollen. Einerseits waren sich viele ihrer Qualifikationen nicht
bewusst, andererseits stellte sich die Notwendigkeit zur Qualifizierung noch
nicht. Unter den ArbeiterInnen war es üblich, sich über Vor- und Nachteile der
verschiedenen Arbeitsstellen auszutauschen, Arbeitsbedingungen und Bezahlung zu
vergleichen und zu fragen, was vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird.
Beispielsweise war es in staatlichen Betrieben üblich, zu Mittag ein Essen zu
bekommen.
Die Fabriken
konzentrierten sich häufig am Rand der Stadt in Bezirken wie beispielsweise
Osmaniye oder Zeytinburnu. Die dort angesiedelten Fabriken wie u.a. Sümerbank,
Aksu, Akfil, Derby, Vita gehörten hauptsächlich der Textilbranche an. Rund um
die Fabriken wohnten mehrheitlich die aus dem Land zugezogenen ArbeiterInnen.
Jene ArbeiterInnen, die aus den Stadtzentren zur Arbeit kamen, waren schon
länger eingesessen, wenngleich auch sie meist ländliche Wurzeln hatten.
Junge Männer migrierten
oft in kleinen Gruppen gemeinsam in die Städte und suchten dort bei Menschen aus
ihrer Herkunftsregion Anschluss. Diese erste Migrationsphase wird von vielen als
Abenteuer und erfahrungsreiche Zeit beschrieben. Ein weiterer wichtiger
Anknüpfungspunkt in den neuen Städten waren Freundschaften, die während der
Militärdienstzeit geknüpft worden waren. Gab es keine Reise- oder sonstigen
Bekanntschaften, auf die zurückgegriffen werden konnte, wurden Moscheen oder
Cafés zu wichtigen Anlaufstellen, um Kontakte zu Personen aus dem Dorf oder
zumindest der Region zu knüpfen. Wenn sie sich aber niedergelassen hatten und
die Familien nachgezogen waren, wurden Nachbarschaftsnetzwerke zum wichtigsten
Bezugspunkt. So vertrauten SchichtarbeiterInnen während der Nachtschicht ihre
Familien der nachbarschaftlichen Obhut an.
Netzwerke über Bekanntschaften und
Freundschaften waren jedoch nicht die einzige Möglichkeit, Zugang zu
Arbeitsstellen zu erlangen. Von Unternehmen eingesetzte ArbeitsvermittlerInnen
suchten die Hotels der ZuwanderInnen auf, um Angestellte für die Fabrik zu
finden. Die möglichen Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen wurden von den
ArbeitsvermittlerInnen üblicherweise[23]
wesentlich besser dargestellt, als sie tatsächlich waren. Diese ersten
Arbeitsgelegenheiten waren für die wenigsten, die gerade erst ihren Unterhalt
als ArbeiterInnen zu verdienen begonnen hatten, befriedigend. Aufgrund fehlender
finanzieller Ressourcen war es schwierig, in der Stadt das Überleben zu sichern,
eine Rückkehr ins Dorf war allerdings auch keine Option.
Die städtische Lebensweise wurde in den
Dörfern mit Neugierde wahrgenommen. Vor allem die Kleidung der in die Dörfer auf
Besuch kommenden Verwandten schürte diese Neugierde, war doch die Kleidung der
sichtbarste Ausdruck von Urbanität. Es war nicht ausschlaggebend, ob viel oder
kein Geld mitgebracht wurde, das Leben in der Stadt galt jenem auf dem Land auf
jeden Fall als überlegen. Die Stadt stand für Abenteuer, die allen offen
standen, und für die Möglichkeit bzw. den Beginn eines besseren Lebens. Die
migrierenden Männer und Familien, die später nachkommen sollten, hofften auf die
Möglichkeiten, die sich in der Stadt bieten sollten. In den folgenden Jahren
wurden auch die besseren Bildungschancen der Kinder zu einem entscheidenden
Migrations-Motiv[24].
Sich in einer Stadt fest
niederzulassen, war für Abenteurer nicht üblich, sie reisten von Stadt zu Stadt.
Viele waren noch sehr jung – zwischen 14 und 20 – und sammelten so bereits
Erfahrungen für ein kommendes Leben in der Stadt. Hatten sie genug Geld für
städtische Kleidung und die Rückfahrkosten verdient, kehrten sie wieder in ihre
Dörfer zurück. Männliche ArbeitsmigrantInnen, vor allem jene der ersten
Generation, verdingten sich überwiegend durch befristete Arbeitsverhältnisse –
beispielsweise als Zement- oder Bauarbeiter. Sobald sich andernorts eine bessere
Arbeit fand, wurde das ursprüngliche Arbeitsverhältnis gekündigt und die neue
Arbeit angenommen. Arbeitsangebote wurden verglichen, alle Möglichkeiten
erwogen. Ganz egal, wo, ob zuerst in Istanbul und dann in Adana oder Aydin:
Arbeit wurde angenommen und dann, wenn sich woanders Besseres fand, wieder
weitergezogen. Üblicherweise wurde in kleinen Gruppen, mit Freunden, gereist.
Bei Ankunft in der Stadt lösten sich die „Reisegruppen“ oft wieder auf. Wurde
hingegen das Ziel verfolgt, sich in der Stadt niederzulassen, war es nicht
unüblich, gemeinsam ein Haus, meist am Stadtrand – in den Gecekondus –, zu
mieten, allerdings nur solange, bis genügend Geld für den Familiennachzug und
eine eigene Wohnung verdient war.
Oft reiht sich ein
Übergangsjob an den nächsten, bis ein regulärer Arbeitsplatz gefunden werden
konnte. Die Möglichkeit eines fixen Arbeitsverhältnisses bot die Fabrik. Kontakt
konnte über Freunde hergestellt werden, oder man ging direkt dorthin, um nach
Arbeit zu fragen.
Zwei Arbeitsverhältnisse
zu haben, war keine Seltenheit. Das erste Arbeitsverhältnis war oft ein
regulärer Job, der zweite – beispielsweise als Warenauslieferer - nur
vorübergehend. Nicht selten war der reguläre Job Ursprung für den zweiten;
fehlerhafte Produkte wurden weiterverkauft, oder - als Kühlschränke noch rar
waren - Eis, das in der Fabrik bezogen werden konnte, verkauft.
Der enge Kontakt vieler
FabriksarbeiterInnen zu ihren Dörfern resultierte in einer hohen Fluktuation in
der Fabrik. Männer wie Frauen waren nach wie vor wichtige Arbeitskräfte für die
landwirtschaftliche Arbeit in ihren Heimatregionen. Im Sommer verließen viele
die Fabrik, um bei der Feldarbeit zu helfen. Obwohl dies dem regulären Charakter
der industriellen Arbeit zuwider lief, wurden diese irregulären
Arbeitsunterbrechungen akzeptiert, da ein hoher Bedarf an Arbeitskräften bestand[25].
Staatliche Betriebe
zählten zu den beliebtesten Arbeitsplätzen, nicht weil die Arbeitsbedingungen so
viel besser gewesen wären, sondern weil hier zu Mittag Essen und einmal im Jahr
Kleidung ausgegeben wurde. Wie einer der Interviewpartner erzählte, war es
schwierig, eine solche Stelle zu bekommen: „Vor den Fabriken haben sich Leute
auf Arbeitssuche versammelt, bei den privaten Unternehmen war es leichter,
eingestellt zu werden. Bei den staatlichen war es weitaus wichtiger, Referenzen
vorlegen zu können.“
Dennoch waren nicht alle
ArbeiterInnen in staatlichen Betrieben regulär beschäftigt. Auch hier gab es
(vor allem für die unqualifizierte Arbeit) befristete Arbeitsverhältnisse.
Regulär Beschäftigte genossen den Vorteil, Zugang zu langfristigen Krediten zu
haben, und so den Kauf von Wohnungen finanzieren zu können – für befristet
Beschäftigte bot sich diese Möglichkeit nicht. In sozial abgesicherten
Arbeitsverhältnissen war es üblich, sich den Urlaub ausbezahlen zu lassen. Oft
wurde über mehrere Jahre hinweg kein Urlaub in Anspruch genommen. Wenn auch ein
Grund dafür der höhere Verdienst war, so war der Wunsch, als „guter Arbeiter“
anerkannt zu werden, ein weiterer Motivationsgrund. Ein „guter Arbeiter“ zu
sein, war auch ein Weg, sich den Ansprüchen des neuen Lebens in der Stadt
anzupassen, und die Fabrikarbeit wurde auf jeden Fall als Verbesserung gegenüber
jener Zeit angesehen, als ein anstrengender, zeitlich befristeter Vertrag den
anderen ablöste. Sich Grundkenntnisse in Lesen und Schreiben anzueignen, ein
technisches Verständnis zu entwickeln, die Bereitschaft, Überstunden zu leisten
und paternalistische Beziehungen zu beherzigen, waren der beste Weg, um ein
„guter Arbeiter“ zu werden. Diese Erwartungen wurden auch gegenüber den neu
Hinzukommenden reproduziert.
Der Eintritt in die Fabrik war nach den
harten Jahren der befristeten Arbeitsverhältnisse für die meisten kein
traumatisches Erlebnis. Ich hätte zwar Berichte über Ängste, Unwohlsein und
Sorgen erwartet, ähnlich Chaplins Erfahrung in Modern Times, aber keiner
der Interviewpartner sprach über seine ersten Erfahrungen mit der
Fabrikdisziplin und dem neuen Zeitregime. Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit
sagen, ob der Grund in dem Bedürfnis liegt, sich als erfolgreich im Anpassen an
das neue Leben zu präsentieren und somit keine Schwäche und Unsicherheit
zuzulassen, oder ob die Fabrikarbeit einfach der vorhergehenden Arbeitsperiode
vorzuziehen war. Beschreibungen über Anpassungsprozesse an den neuen
Zeitrhythmus und die Fabrikordnung lassen sich eher in Romanen und Erzählungen
finden[26].
Akin beschreibt in seinen Arbeiten die Anstrengungen, die mit der Durchsetzung
neuer disziplinierender Methoden verbunden waren, wie den Wandel der
Zeitverwendung, der mit dem Wechsel von der Landwirtschaft in die Fabrik
einhergeht[27].
Nichtsdestotrotz galt es
sich an Disziplin und Produktivitätszwänge anzupassen. Die großen Menschenmassen
und die Maschinen erzeugten Unbehagen. Im Vergleich zu den vorhergehenden
Arbeitserfahrungen bedeutete die Fabrik einen regulären Job und finanzielle
Absicherung. Auch bestehende Arbeitsrechte, wie der Anspruch auf
Überstundenzahlungen, wurden erlernt und genutzt. Unter KollegInnen und
NachbarInnen wurden Erfahrungen ausgetauscht und Informationen weitergegeben.
„Um zu zeigen, dass ich
ein guter Arbeiter bin, bin ich immer etwas später von der Arbeit gegangen. Am
Ende des Monats bekam ich zusätzliches Geld. Ich fragte danach, wofür dieses
Geld sei, und sie sagten mir, dass ich es für die geleisteten Überstunden
erhalten hätte. Sie haben die Stunden gezählt und honoriert.“
Sich an die neuen
Bedingungen anzupassen und dem Bild eines „guten Arbeiters“ zu entsprechen,
konnte auch zu Konflikten mit den nachgezogenen Bekannten und Verwandten führen:
„Ich habe einige Leute aus
meinem Dorf entlassen. Ich habe ihnen einen Job verschafft, und sie waren faul.
Ich habe ihnen gesagt, sie sollen zurück in ihr Dorf gehen.“
Kinderarbeit war üblich.
Viele ArbeiterInnen zogen es vor, dass ihre Söhne sie bei der Fabrikarbeit
unterstützten und so das Familieneinkommen aufbesserten, als dass sie ihre Zeit
spielend auf der Straße verbrachten. Auch die Vorgesetzten ermutigten ihre
ArbeiterInnen, die Kinder in die Fabrik zu mitzunehmen: „Warum bringst du dein
Kind nicht mit? Es ist doch besser, wenn es etwas lernt, als nur auf der Straße
zu sein.“ Einer der Interviewpartner berichtete stolz, vielen Kindern aus der
Nachbarschaft Arbeit in seiner Fabrik verschafft zu haben.
Viele der Frauen, die ihren Männern aus
dem Dorf in die Stadt nachfolgten, gingen offiziell keiner Arbeit nach. Doch
dieses Bild bestand mehr in den Köpfen der Männer[28].
Frauen verrichteten überwiegend Arbeiten, die zuhause gemacht werden konnten.
Die weiblichen Nachbarschaftsnetzwerke informierten über verschiedene
Arbeitsmöglichkeiten. So wurden beispielsweise Arbeiten von Textilfabriken
übernommen, Lebensmittel für die Konservenherstellung zubereitet oder die Wäsche
für allein stehende Männer gewaschen. Die Mund-zu-Mund-Propaganda war für Männer
und Frauen die erfolgreichste Methode der Jobvermittlung.
Auch wenn die Männer nicht
gern sahen, dass ihre Frauen einer Lohnarbeit nachgingen, so galt diese
Einstellung nicht mehr für ihre Töchter. Eine erwerbstätige Tochter zu haben,
symbolisierte die Integration in die städtische Lebensweise, vorausgesetzt
allerdings, der Arbeitgeber galt als vertrauenswürdig und war von jemand
empfohlen worden. Ihre Frauen sollten nicht arbeiten; wenn es aber die Töchter
taten, entsprachen sie dem städtischen Lebensstil. Die Männer versuchten auch,
in derselben Fabrik Arbeit für ihre Töchter zu finden, um sie besser im Auge zu
haben. Im Gegensatz zu den Buben begannen die Mädchen erst etwas später zu
arbeiten.
Jene wenigen MigrantInnen,
die im Stadtzentrum lebten, hatten eher Zugang zum kulturellen Leben der Stadt
und den vielfältigen Angeboten, vor allem für Frauen boten sich hier mehr
Möglichkeiten. Erfahrungen mit dem multiethnischen Charakter der Stadt wurden
gemacht; einige hatten amerikanische oder griechische NachbarInnen. Ein
Interviewpartner erzählt, wie er einen guten Bekannten, mit dem er schon einige
Male geplaudert hatte, auf der Straße fragte, ob er mit ihm gemeinsam das
Morgengebet in der Moschee sprechen wolle. Nach Rückfrage erfuhr er den Grund
für dessen Ablehnung: Er war nicht moslemisch.
MigrantInnen, die im Stadtzentrum
lebten, verbrachten ihre Freizeit beispielsweise auf den Prinzen- Inseln[29]
und in Parks. Frauen verbrachten ihre Freizeit gemeinsam mit Freundinnen
ebenfalls an diesen Plätzen. MigrantInnen im Zentrum und männliche MigrantInnen,
die am Stadtrand wohnten, genossen die Vorzüge der Stadt und erforschten die
Möglichkeiten, die ein Leben in der Stadt zu bieten hat. Keyder hebt allerdings
hervor das, dass die städtische Kultur den Massen zunächst verschlossen blieb[30].
Die ArbeiterInnenklasse konnte aber Zugang dazu erlangen, wenngleich dies für
Migranten leichter war als für Migrantinnen. Migranten gaben einen Teil ihres
Geldes ohne ihre Familien für Vergnügungen im Zentrum aus. Viele holten auch
Grundschulabschlüsse nach, um ihre (Arbeits-) Chancen in der Stadt zu
verbessern.
Die Klassendifferenzen
wurden im Stadtzentrum sichtbarer als an der Peripherie. Eine der Töchter der
Interviewten bemerkte, sie habe bereits als Kind gemerkt, dass zwischen ihr und
den „Offiziellen“ ein Unterschied bestand, obwohl sie damals noch nicht einmal
gewusst habe, was „offiziell“ bedeute.
Kontakt zu den
Herkunftsdörfern wurde aufrechterhalten, wenngleich sich die Gründe dafür
wandelten. So stellten die Nahrungsmittel vom Dorf eine kleine, aber dennoch
willkommene Unterstützung für die StädterInnen dar; und den Neuankömmlingen vom
Dorf wurde Unterkunft gewährt, bis sie selbst genug verdienten.
Schlussfolgerungen
Die Migration der 1950er-Jahre war von
der Hoffnung auf ein besseres Leben und den Beginn eines sozialen Aufstiegs
getragen. Die Beziehungen zu den Herkunftsdörfern waren vor allem zu Beginn
-durch die regelmäßige Rückkehr in den Sommermonaten - sehr eng und blieben auch
später durch weitere Unterstützungsleistungen aus den Dörfern aufrecht.
Arbeitsmöglichkeiten bestanden in privaten oder öffentlichen Unternehmen. Die
Investitionen stiegen aufgrund der amerikanischen Unterstützungsprogramme
schnell an. Die Vereinzelung in der Landwirtschaft, die Atmosphäre des
Mehrparteiensystems und die Nachkriegssituation zogen viele in der Hoffnung auf
ein besseres Leben vom Land in die Stadt. Auch der abenteuerliche Charakter der
Städte war für viele ein wichtiger Grund um das eintönige Leben auf dem Land
gegen ein Leben in der Stadt zu tauschen. Den Problemen, die das Leben in der
Stadt mit sich brachte, wurde auf verschieden Weisen begegnet, dabei wurden
unterschiedliche Taktiken entwickelt. Nach Makal sind vor allem vier Merkmale
der 1950er-Jahre wesentlich für die Klassenbewegung der 1960er-Jahre: die auf
individueller Ebene gesammelten Arbeitserfahrungen, dass die Arbeitsplätze zu
einem Ort von Arbeitskämpfen wurden, die Ansiedlung der ArbeiterInnen rund um
die Fabrik und die daraus resultierende Herausbildung von Klassenbewusstsein,
und die Stärkung von Gewerkschaften[31].
Die Kontakte und
Beziehungen der ArbeitsmigrantInnen waren vorerst auf Verwandte und Personen aus
dem Herkunftsdorf beschränkt und dehnten sich später auf die erweiterte
Nachbarschaft und Arbeitskontakte aus. Die Regeln der Industriedisziplin wurden
erlernt, aber die zweite Generation war den Verheißungen der Stadt gegenüber
schon weitaus skeptischer.
Keyder zeigt, dass
MigrantInnen der zweiten Generation ein ausgeprägter klassenspezifisches
Verhalten zeigten, und zwar zunehmend in dem Maße, in dem die Peripherien
stärker mit den Stadtzentren interagierten. Es scheint auch, dass das noch
weniger klassenspezifische Verhalten der ersten Generation stärker auf den
Anerkennungswunsch in der Stadt abzielte, da sie Angst hatte, von den
Möglichkeiten urbanen Lebens ausgeschlossen zu werden. Die MigrantInnen der
zweiten Generation hingegen waren bereits StadtbewohnerInnen, die sich den
unzureichenden Lebensbedingungen in der Stadt widersetzten. Sie verglichen ihre
Lebensbedingungen in den Städten mit jenen ihrer Eltern, während diese die
Vorzüge der Stadt noch gegenüber den meist schlechteren Lebensbedingungen auf
dem Land sahen.
Kartal unterscheidet so
zwei Phasen urbanen migrantischen Lebens: Eine erste, in der sich die Menschen
selbst als „relativ wohlhabender“ als zuvor wahrnahmen, und eine zweite, in
welcher sie sich als „relativ benachteiligt“ sahen. Aus diesen Gründen neigten
erstere auch zur Wahl konservativer Parteien, zweitere hingegen zu Parteien, die
eine Änderung des bestehenden Systems versprachen.
Die IndustriearbeiterInnen
der 1950er-Jahre gehörten zwar einer gemeinsamen Klasse an, sie konstituierten
aber keine homogene Masse. Ohne die Heterogenität der Alltagserfahrungen zu
leugnen, gewinnen sie doch erst durch den gemeinsamen Kontext an Bedeutung.
Sonst hätten wir nur die Erinnerungen, aber keine gemeinsamen Anknüpfungspunkte,
um Antworten auf aktuelle Fragen geben zu können. Wie
Yiğit Akın
zeigt, sind individuelle Erfahrungen äußerst wichtig für die Geschichte der
ArbeiterInnen. Erfahrungen sind nicht bloß Anekdoten, sie geben uns vielmehr
Anhaltspunkte für die Politik von heute.
[1]
E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, Harmondsworth :
Penguin Books, 1968
[2]Richard
Johnson, “Thompson, Genovese, and Socialist Humanist History”, History
Workshop, 6, 1978, pp.79-100
[3]Vefa
Saygın Öğütle & Güney Çeğin, Sosyo-Tarihsel Teorinin Sınıfla İmtihanı,
Duvar, 2007, p 88
[4] E.P.Thompson, Custom in Common, London: Penguin, 1993. In diesem Buch entwickelt Thompson das Konzept der “moral economy”.
[5]Hakan
Koçak, 50’leri İşçi Sınıfı Oluşumunun Kritik Bir Uğrağı Olarak Yeniden
Okumak, Çalışma ve Toplum, 2008/3
[6]
Zafer Toprak, ATA Lecture Notes:
http://www.ata.boun.edu.tr/Faculty/Zafer%20Toprak/ATA_522_PART3_fall2007.ppt
[7]
Ahmet Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri:
1946-1963, İmge Kitabevi, 2002
[8]Mustafa
Delican, Cumhuriyet Döneminde Türk Endüstri İlişkileri, İşçi
Sendikalarının Dünü, Bugunü, Sosyal Siyaset Konferansları, Kitap 51,
http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2275&Itemid=59
[9]
Ahmet Makal, Ameleden İşçiye, İletişim Yayınları, 2007
[11]
Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, 1989
[13]
Ahmet Makal, Ameleden İşçiye, İletişim Yayınları, 2007. Das Konzept der
“Solidarität” stammt ursprünglich aus Dürkheims “organic solidarism”.
[14]
„Encloseure“ (dt. Einhegung) in der Türkeit ist der Prozess, bei dem
Gemeindeland privatisiert wird und die BäuerInnen dadurch gezwungen
werden vom Land in die Städte zu siedeln. Das bekannteste Beispiel ist
England im 18. Jahrhundert. Teilweise geschah ähnliches auch im Osten
der Türkei.
[18]
Vgl. Giddens, The Consequences of Modernity, Polity Press, Stanford,
1992 by Oğuz Işık&Melih Pınarcıoğlu in “Nöbetleşe Yoksulluk”, İletişim
Yayınları, 2001
[20]“Freier
Arbeiter”wird hier im Marxschen Sinn verwendet: Er besitzt nichts als
seine Arbeitskraft, um zu überleben.
[21]Sema
Erder, Kentsel gerilim: enformel ilişki ağları alan araştırması, 1997
[22]Zur
Zeit der Kriegswirtschaft musste ein Teil der Ernte an offizielle
Stellen abgeführt werden. Dies führte zur Verarmung der Landbevölkerung
und zu Konflikten mit den Behörden.
[23]
Die ArbeitsvermittlerInnen nehmen in den Arbeitsbeziehungen der
damaligen Perioden eine wichtige Rolle ein – eine weiterführende
Untersuchung wäre lohnend.
[24]
Zeki Erdoğmuş, Kırsal bölgelerden Ankara, Kıbrıs-Bayraktar İlkokulu
gecekondu bölgesine göç ve göçedenlerin kentlileşmesi, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, 1978. Nach einer Studie von Zeki Erdoğmuş,
basierend auf einer quantitativen Befragung in den gecekondus von
Ankara, stellt der Wunsch nach einer guten Ausbildung für die Kinder den
drittwichtigsten Migrationsgrund dar.
[25]
Yıldırım Koç, 1923-1950 Döneminde CHP’nin İşçi Sınıfı Korkusu,
Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 8, Sayı: 170, p: 43-44
[26]
Als Beispiel seien, Lilo Linke, Mustafa Kemal Türkiyesi: Modern Türkiye
Seyahatnamesi, İkarus Yayınları, 2008 und die Romane von Orhan Kemal
genannt.
[27]
Yiğit Akın, “Erken cumhuriyet dönemi emek tarihçiliğine katkı: Yeni
yaklaşımlar, yeni kaynaklar”, Tarih ve Toplum Yeni Taklaşımlar,
Volume:2, p92, 97, 98, und Yiğit Akın, Gürbüz Yavuz Evlatlar, Erken
Cumhuriyette Beden Terbiyesi ve Spor, İletişim Yayınları, 2004
[28]
Die Interviewpartner haben selbst nicht über Frauen in der Lohnarbeit
berichtet, aber die beim Interview anwesenden Mütter und Töchter haben
es bestätigt.
[29]
Die Prinzeninseln sind für ihren bourgeoisen Lebensstil bekannt.
[30]
Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, 1989,
p:170
[31]
Ahmet Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri:
1946-1963, İmge Kitabevi, 2002
|
