|

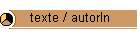

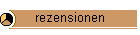



| |
Martin Birkner:
Auf Uhren schießen
Gedanken zu
einem Symposium über John Holloways Buch „Die Welt verändern ohne die Macht
zu übernehmen”
Neben Hardt
und Negris Buch Empire (Hardt/Negri 2003) ist Die Welt verändern ohne
die Macht zu übernehmen (Holloway 2002) wohl das meistdiskutierte Buch in
Sachen revolutionärer Theoriebildung der letzten Jahre.[1]
Ein Symposium der britischen Zeitschrift Historical Materialism widmete
sich im vergangenen Jahr der Thematik. Da ein wesentlicher Aspekt des
Klassenkampfes in der Theorie, dem sich die grundrisse-Redaktion
verschrieben hat, in der Vorstellung und Reflexion linker Debatten außerhalb des
deutschen Sprachraums besteht, sollen im vorliegenden Essay die Debattenbeiträge
präsentiert und kommentiert werden.[2]
Wie Historical Materialism überhaupt so ist auch die theoretische
Spannbreite des Symposiums für hiesige Verhältnisse nahezu unvorstellbar breit.
Ob dies allerdings zu einer fruchtbaren Diskussion unter den TeilnehmERn geführt
hat, ist aus der Zeitschrift selbst nicht ersichtlich und muss auch – aus
Gründen die im Folgenden genannt werden – bezweifelt werden. In der Ausgabe
13.4. von HM wurden neben einer editorischen Vorbemerkung fünf Debattenbeiträge
sowie eine summarische Antwort von John Holloway abgedruckt.
Dass auf
zwei der fünf Beiträge nicht eingegangen wird, mag als arrogante Haltung
gegenüber gewissen marxistischen Strömungen kritisiert werden; der Autor dieser
Zeilen ist jedoch überzeugt, den LeserInnen einiges an Mühsal zu ersparen, die
aus der Wiederkehr der immergleichen trotzkistischen Mantras (Daniel Bensaid)
oder dem vulgärmaterialistischen Abqualifizieren der Hollowayschen Gedanken als
„Idealismus”, „Nein zum marxschen Kapital” und ähnlichen Schagworten (Michael A.
Lebowitz) resultieren. Drei Beiträge – auch sie sind unterschiedlich gelagert in
Kritik und Herangehensweise – lassen sich hingegen auf Holloways Theorie im
Gegensatz zu den beiden vorgenannten ernsthaft ein. Sie sollen im Folgenden
vorgestellt werden. Im Anschluss daran wird die Antwort John Holloways
dokumentiert, die trotz ihrer Kürze wiederum Rückschlüsse hinsichtlich der
Plausibilität der zuvor geäußerten Kritiken zulässt. Abschließend wollen Fragen
noch auf Leerstellen in Holloways Buch und auch in den Symposiums-Beiträgen,
aber auch auf mögliche Anknüpfungspunkte hingewiesen werden. Eine Maxime aus
Holloways Antwort mag auch hier gelten: „Mich interessiert nicht die ‚Analyse
herrschender Gruppen‘ sondern die Bewegung des Kapitals als soziales Verhältnis”
(277). Hinzuzufügen wäre freilich noch – ganz im Sinne John Holloways – „im
Hinblick auf seine Überwindung”.
Bevor ich
mich im einzelnen mit den Beiträgen auseinandersetze möchte ich noch kurz auf
die begrifflichen Achsen hinweisen, um die sich die Diskussion dreht: Dies ist
zum einen die (theoretisch-praktische) Frage nach dem Stellenwert der
Negativität sowie der Zentralität des Fetischismusbegriffes (eines
Fetischismusbegriffes, der als prozessualer, als Prozess der
Fetischisierung und dem Kampf dagegen zu verstehen ist), zum anderen jene
(politisch-praktische) nach der unmöglichen Möglichkeit von Organisierung und
Konstitution. Die oben bereits angesprochen Leerstelle bei Holloway wie seinen
Kritikern wird sich abschließend noch einmal auf die Stellung und/oder Bewegung
dieser beiden Achsen zu- und/oder voneinander auftun – hoffentlich produktiv.
Negative Dialektik,
synthesefrei
Marcel
Stoetzler´s Beitrag dreht sich um die Negative Dialektik im Zentrum des
Hollowayschen Theoriegebäudes. Als autonomer Adornit (was jenseits des kleinen
Teichs so alles möglich ist) wirft Stoetzler einen scharfen Blick auf die Kraft,
aber auch auf die Unzulänglichkeiten und Vermengungen, die Holloways Verständnis
von Negativität implizieren: Der Klassenkampf ist nicht eine Auseinandersetzung
bereits fertig konstituierter sozialer Entitäten sondern vielmehr eine um und
gegen das Klassifiziert-Werden. Soweit folgt Stoetzler der Argumentation
Holloways: „Nur insofern wir nicht ArbeiterInnenklasse sind, kann die Frage
nach Emanzipation überhaupt gestellt werden, aber nur insofern wir die
ArbeiterInnenklasse sind, haben wir das Bedürfnis, sie zu stellen” (195). Er
teilt auch das daraus resultierende nicht-reduktionistische Verständnis von
Politik. Der Kampf gegen das Klassifiziert-Werden ist eine Artikulation des
Nicht-Identischen gegen die identifikatorischen Bewegungen von Kapital, Partei,
Nation und Staat.
Diese auf
Negativität begründeten Subjektivitäten vermengen aber, so Stoetzler, drei
verschiedene Aspekte zu einem indifferenten „Fluss des Tuns”: Das „Tun im
Allgemeinen”, das „Schreien gegen die Herrschaft” und den „wirkungsvollen
Widerstand” gegen ebendiese (vgl. 197). Das Prinzip der Würde dient Holloway
dabei als ein, der quasi-anthropologische Einsatz des Fluss des Tuns als ein
anderer Bestandteil der nach Stoetzler unzulässigen Vermengung dreier zu
unterscheidender Aspekte der sozialen Auseinandersetzung. Die Abgrenzung der
Aspekte sei aber von großer Bedeutung nicht zuletzt in der Bekämpfung
reaktionärer (Gesichtspunkte) sozialer Bewegungen, wie beispielsweise eines
„antisemitischen Antikapitalismus” (204, was wieder ziemlich an diesseits des
kleinen Teichs erinnert ...). Dass es dabei keinen der Dialektik von
Fetischismus und Entfetischisierung externen Maßstab gibt, ist gleichzeitig und
–wertig Notwendigkeit der streng immanenten Konzeption Holloways und wirft doch
ein zentrales Problem des paradoxen Revolutionsbegriffes von Holloway auf.
Stoetzler: „Was Holloway kreative Macht (i.O.
“power-to-do”, Anm. MB) nennt, kann nur in der
aktuell vorherrschenden Form als instrumentelle Macht (i.O. power-over, Anm. MB)
existieren” (203). Wie ist also
Entfetischisierung, wie ist Revolution überhaupt denkbar, wenn wir uns notwendig
in einem Fetischuniversum bewegen? Hier bewegt sich Holloway auf dünnem Eis,
wenn er, wie von Stötzler oben kritisiert, Zuflucht in den quasi-ontologischen
Sphären des „Tuns im Allgemeinen” suchen muss.
Auch der
vielleicht „all-zu-dialektische“ Machtbegriff Holloways weist analoge Schwächen
auf. Die „instrumentelle Macht [ist] nichts weiter als die Metamorphose
kreativer Macht und deshalb vollkommen von dieser abhängig” (Holloway 2002,
51). Die Bewegungen der kreativen Macht können sich nur als gleichzeitig
innerhalb des Raumes der und antagonistisch zur
instrumentellen Macht artikulieren. Holloway nennt dies „Anti-Macht, etwas, das
sich radikal von instrumenteller Macht unterscheidet” (ebd.). Die Verwandlung
der Metamorphose zum radikal Anderen, von der Kreativität zum „Anti” zeigt
bereits die Schwierigkeiten an. Wenn dann der revolutionäre Prozess die Macht
gleich gänzlich auflöst, dann scheint die Sonn´ wahrlich ohn´ Unterlaß:
„Anti-Macht ist deshalb keine Gegenmacht, sondern etwas sehr viel Radikaleres:
Es ist die Auflösung instrumenteller Macht, die Emanzipation kreativer Macht.
Dies ist die große, absurde(sic!), unvermeidliche Herausforderung des
kommunistischen Traums: durch die Auflösung instrumenteller Macht eine freie
Gesellschaft ohne Machtbeziehungen zu schaffen” (Holloway 2002, 51f.,
Herv. MB).
Die
Beziehungen zwischen verschiedenartigen sozialen Kämpfen stellt sich über die
„Gemeinsamkeit ihres negativen Kampfes gegen den Kapitalismus” (209) her. Wie
aber sieht die Beziehung der rein negativen Kämpfe zum unhintergehbaren „Fluss
des Tuns” aus? Welche Rolle spielt das Begehren der Beteiligten, die gemeinsamen
Wünsche und Ängste? Holloway verortet die revolutionären Prozesse zunächst in
der Sphäre des Alltäglichen. Ist aber genau das Zerbrechen der kapitalistisch
verfassten Zeit, das von Holloway geforderte „Schießen auf die Uhren” (274)[3]
nicht die bestimmte Negation des Alltäglichen? Während Stoetzler angesichts der
„Identifizierungs-Gefahr” der von Holloway ins Treffen geführten „taktischen
Identität” aller neu aufkeimenden sozialen Bewegungen (Frauen, Schwarze,
Homosexuelle, Indigene) lieber doch auf das vermeintlich sichere Terrain
aufklärerischer Kritik flüchtet (213f.), packt Massimo De Angelis die
Problemstellungen deutlich entspannter an. Er stellt nicht wie Stoetzler die
negative Dialektik, sondern eine „immer schon existierende Multitude der
verschiedenen ‚JAs’“ (so Guido Starosta in seiner Einleitung, 165) sowie die
Frage nach Möglichkeit und Notwendigkeit politischer Organisierung ins Zentrum
seines Beitrages.
Der Beitrag
von Massimo De Angelis beginnt mit einem wichtigen Hinweis methodischer Natur
oder vielmehr mit einem Dilemma. Wolle mensch die Aussagen von Holloways Buch
ernst nehmen, so verbietet sich jede Definition, jedes „es geht um dies
oder das” (233). Gleichzeitig möchte De Angelis aber den gemeinsamen Boden
definieren, den er durch und über seine politische und theoretische Arbeit
mit Holloways Buch teilt. So wirft De Angelis sein anfängliches Vorhaben,
nämlich in seinem Schreiben über das Buch dessen Intuition, mithin die, dass
jede Definition, jede Identifikation Herrschaft bedeutet, sofort wieder über
den Haufen, um das Gemeinsame zu definieren, nein, es vielmehr aus dem Vorwort
der englischsprachigen Ausgabe von „Die Welt verändern ohne die Macht zu
ergreifen” herbeizuzitieren: „Wie können wir trotz alledem unsere eigene
Kraft verstehen, unsere Fähigkeit eine andere Welt zu erschaffen?” (234).
Dies führt ihn schnurstracks zu seinen zwei zentralen Kritikpunkten, dem „NEIN”
als Ausgangspunkt sowie der „Abwesenheit der Problematik von Organisation”
(235). Diese zwei Punkte, unter den Titeln „Kommunikation der Kämpfe” und
„Konstituierende Macht” auch aus der – im Übrigen von De Angelis wie von allen
anderen Autoren des HM-Symposiums auffällig unauffällig be- und verschwiegenen –
Theorie Hardt und Negris bekannt, bilden fortan den Fokus der Überlegungen De
Angelis´. Allerdings nicht ohne Umwege, auf denen sich bei näherer Betrachtung
allerdings vortrefflich fragend voranschreiten lässt.
St. John says ...
Gegen den
Schrei der Negativität, das NEIN als Ausgangspunkt setzt De Angelis eine
„Multitude von JAs”, die dem vereinheitlichenden Moment – eben als NEIN –
insofern entgehen, als dass sie Bedürfnisse und Wünsche, Affekte und
verschiedenste soziale Beziehungen vorstellen, nicht weniger also als die
Fähigkeit, eine andere Welt ins Werk zu setzen. De Angelis gesteht jedoch ein,
dass auch ein radikal anderer Ausgangspunkt mitnichten bereits die Frage nach
der „alternativen Artikulation” (237) dieser Multitude „als der zentralen
Problematik der Revolution” (ebd.) beantwortet. Dies führt uns zum Verhältnis
von Schreien, Sprechen und Tun. De Angelis stellt zunächst die Hollowaysche
Entgegensetzung von Sprache und Schrei infrage. Wenn Holloway schreibt, „[i]m
Gegensatz zum Schrei negiert das Wort nicht. Und das Wort schließt auch nicht
einfach Tun mit ein, wie es der Schrei tut” (Holloway 2002, 35), dann wischt
er mit einem Federstreich sämtliche Argumente sprechakt- und
diskurstheoretischer Natur (mithin deren zentrales, nämlich dass Sprechen Tun
ist) vom Tisch und redet einer längst überwunden geglaubten Entgegensetzung
von Schrei=Negativität=Tun=Dialektik=Einheit von Theorie und Praxis und
Sprechen=Denken=Positivität=Trennung von Theorie und Praxis das Wort (vgl.
Holloway 2002, 35f.).[4]
... yes!
Dem setzt De
Angelis die notwendige Verbundenheit von Sprechen und Tun entgegen, die Frage
ist nicht „ob”, sondern „‚wie‘ das Wort und der Diskurs ein Moment des Tuns
sind” (241). Dieses „Wie” ist nicht nur Anstoß für das Nachdenken über das
Verhältnis von theoretischer und politischer Praxis sondern auch Hintergrund des
politischen Einsatzes hinsichtlich der Rollen und der Beziehung von Imagination
und Konstitution (vgl. 241) für die Überwindung von Herrschaft im Allgemeinen
und jener des Kapitalverhältnisses im Besonderen. Dies führt zum zweiten
Themenkomplex in De Angelis´ Text, der Frage nach Organisation oder vielmehr
nach Organisierung (245). Und wieder wird die Negativität als
Ausgangspunkt zurückgewiesen. Um nicht der notwendig herrschaftlich verfassten
Subjekt-Objekt-Dialektik inklusive ihrer identifikatorischen Ausgangsmomente und
der auf politischem Terrain damit verbundenen Zweck-Mittel-Rationalität auf den
Leim zu gehen, muss der zwangsläufig reduktionistische Ursprung im Schrei (im
Singular) zurückgewiesen werden. Erst die Mannigfaltigkeit unserer JAs
ermöglicht eine nichthierarchische Form von Organisierung, die die Vielfalt
unserer sozialen Beziehungen adäquat zum Ausdruck bringen kann: „Da gibt es
keine Entschuldigung, kein Zögern, dein Modus (mode) des Tuns, des
Organisierens spricht für die Art (type) von Welt, die du willst, ja sie
sind diese Art von Welt!”
(245, Herv.i.O.)
Aber wie?
De Angelis
Verständnis von Organisation beruht also auf der Positivität unserer sozialen
Beziehungen. Vor diesem Hintergrund kann er dann auch gesellschaftliche Kämpfe
in Kommunikation miteinander bringen. Dabei nützt ihm – paradoxer Weise (246) –
der emphatische Begriff des Tuns bei Holloway: Wenn Individuen nicht nur als
Mitglieder partikularer Gruppen unterdrückt sind sondern die gesellschaftlichen
Antagonismen auch die Individuen selbst durchziehen, dann eröffnet sich genau an
dieser Stelle die Möglichkeit des gemeinsamen politischen und also organisierten
Bearbeitens dieser Widersprüche. Allerdings birgt der radikal positive
Machtbegriff der „vielen JAs” auch eine vollständige Auslöschung der negativen
Dialektik Holloways mit sich, was wiederum zu einem Verständnis von sozialer
Auseinandersetzung führt, sich diese als Kampf der (zweier?) Titanen,
ausgestattet mit der jeweiligen „kreativen Macht” vorzustellen (vgl. auch 244).
So leicht macht es sich De Angelis aber dann doch nicht, sind die Titanen doch
in uns beziehungsweise konstituieren ihre Verhältnisse immerhin unsere
Subjektivität. Politische Bewegungen, ihre Organisierung und Strategie
erschaffen in der Auseinandersetzung der an ihr beteiligten Subjekte ihre
eigenen Maßverhältnisse, die bei allem Anerkennen von Differenzen doch immer
wieder auf die ihnen entgegenstehende Macht des Staates treffen. Das Umgehen
(mit) der Tatsache, dass „auch wenn es wahr ist, dass es kein eigentliches
‚wir’ und ‚sie’ gibt, es genauso wahr ist, dass ‚wir’ und ‚sie’ andauernd
produziert werden” (249), erfordert, auch wenn es nicht darum geht, die
Macht zu ergreifen, strategisches Denken.
Hegemonie?
Einen
anderen, wenngleich auch auf ähnlichem Terrain sich befindlichen – Zugang zu
Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen wählt Leigh Binford, der wie
Holloway an der Universität von Puebla in Mexiko unterrichtet. Sein stärker
sozialwissenschaftlich ausgerichteter Blick nimmt einen diskursiven
Dauerbrenner, das Verhältnis von Struktur und Handlung, zum
Anlass, um Schwächen in Holloways Argumentation offen zu legen. Gegen dessen
Zentralbegriff „Fetischismus” reklamiert Bindford die grundsätzliche
Analysierbarkeit kapitalistischer Strukturen, ohne aber einem
„antihumanistischen” (Bindford) Strukturalismus das Wort zu reden. Der
Schlüsselbegriff, der ihm das ermöglicht, ist jener der Hegemonie. Dieses
von Antonio Gramsci geborgte Konzept wird von Bindford allerdings nicht – wie in
der Gramsci-Rezeption auch hierzulande üblich – als Konsens stiftendes, sondern
vielmehr als konfliktuelles eingeführt. So berechtigt seine Kritik an der
ausschließlich philosophisch-negativen Verfahrensweise auch sein mag, der
politizistischen Falle entgeht auch Bindford nicht. Mit seinem letztlich
positiv(istisch)en Verständnis von ArbeiterInnenklasse und dem jenem adäquaten
Verständnis von Politik ist die Defensive die einzig vorstellbare strategische
Ausgangsbasis. „Objektive Bedingungen für revolutionäre Veränderungen” (262)
müssten erst durch die „harte Arbeit(sic!)” (ebd.) der Theoretisierung des
gegenwärtigen Kapitalismus sowie mittels des „Aufbaus von Massenbewegungen”
(ebd.) geschaffen werden. Anbetracht dessen ist John Holloways scharfe Antwort
nur allzu gut nachvollziehbar: „Revolution-in-der-Zukunft macht aus der
‚revolutionären‘ Theorie der Gegenwart eine Theorie der Gesellschaft
anstatt eine Theorie gegen die Gesellschaft” (270, Herv.i.O.). Diese,
so Holloway, „unterscheide sich zwar in ihren Sympathien, nicht aber
methodisch von bürgerlicher Theorie” (ebd.).
Nein!
Die Antwort
John Holloways auf die versammelten Beiträge fällt der Sache gemäß äußerst
unterschiedlich aus. Sie gliedert sich grob in drei Teile: Der Begründung, warum
für eine Theorie der Überwindung des Kapitalismus vom NEIN auszugehen ist,
folgt eine (leider zu) kurze Passage über die historischen und vor allem
zeitlichen Aspekte von Revolution. Abschliessend widmet sich Holloway seinen
Interpreten und Kritikern.
Nicht
weniger als 12 Gründe nennt Holloway für ein Ausgehen vom NEIN. Dieses sei
experimentell, ungehobelt (uncouth), dringlich, Einheit,
der Schlüssel zu unserer Macht, es bricht (die Zustimmung zum
Bestehenden), es ist asymmetrisch, weist auf das Tun, es öffnet,
bewegt, ist eine Frage, ist unmittelbar. Mit Ausnahme eines
dieser Gründe könnten diese allerdings auch für ein Primat der „Multitude der
verschiedenen JAs” – mit De Angelis, aber auch mit Hardt/Negri oder Paolo
Virnos Grammatik der Multitude (Virno 2005) – eingesetzt werden. Nur eine
„negative Einheit“ ist die Multitude mitnichten, geradezu ihr Gegenteil und auch
per definitionem nicht auf eine Einheit zu bringen. In seiner Begründung
schreibt Holloway: „Es ist das Nein welches die interne (vielmehr als die
externe) Einheit der Jas gibt” (266). Hier wird – eingedenk der
Hollowayschen Entgegensetzung von Sprache und Handlung – ein reduktionistisches
Verständnis von Einheit nahe gelegt; eine Einheit, die ein Verständnis der
kreativen Macht letztlich nur als abhängig von Herrschaft (nämlich als deren
VerNEINung) zulässt. Hier zeigt sich erneut der Vorteil eines Begriffs des
Gemeinsamen, Communen (vgl. Hardt/Negri 2004, 196ff.), gegenüber
jenem der Einheit. Paolo Virno weist auf zwei Aspekte dieses Gemeinsamen
hin: auf den biologischen Wahrnehmungsapparat und das Vermögen zu
Sprechen (Virno 2005, 103ff.).[5]
Letzteres wird allerdings, wie oben gezeigt wurde, von Holloway dem Tun
geradezu entgegengesetzt, Holloway kommt in Bedrängnis, wenn er den Prozess der
Revolution als einen der Entfetischisierung denken möchte, ohne
wesensphilosophisch eine (verlorengegangene, entfremdete) Essenz des Menschen
anzunehmen, die im Kommunismus endlich wieder zu sich kommt. Beim Vorgang des (Zer)Brechens,
der von Holloway ebenfalls ins Treffen geführt wird, zeigt sich dieses Problem
von einer anderen Seite; So wird in Die Welt verändern ohne die Macht zu
übernehmen im Bruch des Fluss des Tuns die wesentliche Bewegung der
Herrschaft gesehen (vgl. Holloway 2002, 43), während in der Antwort auf die
Symposiumsbeiträge gerade die Fähigkeit des NEINs zum Bruch – wenngleich
auch zum Bruch von Herrschaft – stark gemacht wird. Gerade Herrschaft existiert
aber durch „den Fluss” ihrer Dauer, die in ihrem eigenen Vermögen, sich selbst
aufrecht zu erhalten, immer auch mehr als „nur” instrumentelle Macht sein muss.
Gerade die – von ihm selbst auch nicht durchgehaltene weil nicht durchhaltbare –
Radikalität seiner Ablehnung, sich auch nur in irgendeiner Weise mit
herrschaftskonstituierenden und –erhaltenden Phänomenen auseinanderzusetzen,
nimmt Holloways Theorie immer wieder die Spitze, weil seine Bilder, seine
Abstraktionen – marxistisch ausgedrückt – keine Realabstraktionen darstellen,
sondern nicht selten spekulative, ja (befreiungs)theologische Züge annehmen.[6]
Wie im Gegenzug aber eine „Fetischisierung” traditioneller marxistischer
Theorien und Organisationsweisen (Objektive Analyse
Þ
politische Anwendung) verhindert werden kann, wie sie aus dem
Marxismus-Leninismus nur allzu bekannt (und mittlerweile zum Glück wirkungslos
geworden) sind und auch z.B. bei Binford durchscheinen, ist eine andere, nach
wie vor offene Frage.
Auf Uhren schießen
Äußerst
inspirierend, wenngleich auch leider zu knapp geworden ist jener Teil, den John
Holloway Fragen der Zeitlichkeit von Revolutionen widmet. Nicht die
traditionelle Konzeption von Revolution, wonach diese immer erst in der
Zukunft stattfindet und in der Zwischenzeit immer eine Menge an
„harter Arbeit” in Sachen Kapitalismusanalyse und Massenbewegungsaufbau (siehe
oben) auf uns wartet, sondern „Revolution jetzt” (271): „Revolution jetzt
bedeutet, dass wir den Tod des Kapitalismus nicht als Dolchstoß ins Herzen
denken, sondern vielmehr als Tod durch eine Million Bienenstiche oder eine
Million Nadelstiche in einen Kredit-aufgeblähten Ballon, oder (besser) eine
Million Risse, Spalten, Klüfte, Sprünge” (ebd.).
Angesichts
der Zumutungen des Kapitalismus ist jeder Moment, den dieser weiterexistiert,
zuviel. Wenn Revolution als vielfältige, nicht einheitlich zur Deckung zu
bringende Formen des Kampfes im Hier und Heute passieren muss, dann kann sie nur
aus den alltäglichen Formen unserer Schreie heraus in die Welt kommen. Wenn
gleich auch Holloway die Frage der Kommunikation der Kämpfe, der Möglichkeit, in
größeren Quantitäten größere Risse im Kapitalverhältnis schneller auszudehnen
(das oben diskutierte „Wie”) nicht ausreichend thematisiert, so ist doch seine
Verortung revolutionärer Prozesse im Alltäglichen eine wichtige Voraussetzung
für das Denken von Politik jenseits von Repräsentation und Elitismus. Und
dennoch ist das Zerbrechen der kapitalistischen Dauer, das Schießen auf die
Uhren, das Stillstellen herrschaftlich verfasster Zeitlichkeit nur als ein
Ausbrechen aus der, ein „Schießen“ auf die eigene Alltäglichkeit denk- und
machbar. Anders gesagt: Nur aus dem kapitalistischen Alltag heraus lässt sich
die Möglichkeit eines post-kapitalistischen „Alltags” denken, das „fragende
Voranschreiten” der Zapatistas ist dabei nicht nur eine Bewegung, sondern muss
auch das Uns-Offenhalten für das, die Bereitschaft zum Ereignis
beinhalten, das dem post-kapitalistischen „Alltag” als aus unserer heutigen
Position Nicht-mehr-Alltag seine Anführungszeichen verleiht.
Die
abschließende Replik Holloways auf die Beiträge soll hier nur anhand jener
dargestellt werden, die auch oben behandelt wurden. Leider, wenn auch angesichts
der manchmal doch ungeheuerlichen Anwürfe in manchen Beiträgen verständlich,
räumt er den weniger interessanten Beiträgen unverhältnismäßig mehr Raum ein als
den spannenden (die auch abschließend hier behandelt werden). Massimo De Angelis,
der in Holloways Buch die Thematisierung der Frage von Organisierung vermisst,
wird entgegnet, dass Organisierung nicht von der Form der sozialen Beziehungen,
die wir – ob wir wollen oder nicht – eingehen (müssen), abgetrennt behandelt
werden dürfe. Die Form dieser Beziehungen ist aber im Kapitalismus notwendig
kapitalistisch und also fetischisiert, was im Kampf dagegen entsprechende
Einsätze (Holloway nennt explizit Horizontalität, Würde und Liebe, 282) vorgibt.
Wie aber, und genau das war De Angelis´ Fragestellung, diese
entfetischisierenden Organisationsformen aussehen könnten, wird verschwiegen (
„es sollen keine Regeln festgelegt werden“ ebd.), wir drehen uns im Kreis. Dabei
würde hier beispielsweise die Rückbesinnung auf die operaistischen Diskussionen
über Klassenzusammensetzung gerade hier einen Spielraum öffnen, der
sowohl die oben eingeforderte Ebene strukturaler Analyse wie auch jene der
Organisierungsformen historisch und analytisch bearbeitbar machen könnte.
Holloway, der diese Debatten kennt, spricht die Thematik auch kurz an (274),
führt aber den Gedanken nicht weiter aus.[7]
Harte Arbeit ...
Auch die
Auseinandersetzung mit Stoetzlers Text fällt kurz aus, obwohl Holloway, wie er
selbst schreibt, „auf so eine Art von Kommentar gehofft hat, als er das Buch
schrieb” (282f.). Stoetzlers Hauptkritikpunkt, die Vermengung dreier Aspekte in
Holloways Konzept von Negativität kann letzterer dann auch einiges abgewinnen.
Dennoch überantwortet Holloway die Austragung der Konflikte, die in der
Vermengung verschiedener Aspekte ihren Grund haben, den jeweiligen sozialen
Bewegungen und entzieht sich so eines genaueren Überprüfens seiner eigenen
theoretischen Konstruktionen. Die von ihm angesprochene und bevorzugte
Räte-Konzeption kommt so in den Geruch eines quasi-neutralen Behälters, wo es
nicht mehr um die, ja, Erringung von Hegemonie innerhalb bestimmter kollektiver
Subjekte geht, sondern wo ein relativ unproblematischer Aushandlungsprozess die
internen Widersprüchlichkeiten glättet. In diesem Aspekt ähnelt die Hollowaysche
Konzeption jener der Multitude von Toni Negri und Michael Hardt –
zumindest in ihren schwachen Momenten: dann erscheint die Multitude als
unhintergehbare und unschuldige Vielheit, die qua ihrer Konstitutionsbedingungen
gegen hierarchische Organisationsformen, männliches Dominanzverhalten und
rassistische Teilungen immun ist. Ohne im Zweifelsfall den Rückzug Stoetzlers in
die Kritik nachzuvollziehen, müssen Formen politischer Organisierung heute doch
in einem Prozess ständiger Neukonstitution die niemals neutralen Bedingungen und
Asymmetrien fortwährend kritisch reflektieren. In dieser einen Hinsicht also
doch harte Arbeit.
Eine(?) Frage zum Schluss
Eine
grundsätzliche Frage drängte sich dem Autor bereits während dem Lesen von „Die
Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen” vor drei Jahren auf und stellte
sich auch beim Lesen der Symposiums-Beiträge erneut: Warum ist für John
Holloways Denken die aktuelle Transformation der Arbeitsverhältnisse von so
geringer Bedeutung? Ist nicht diese Transformation letztlich als Effekt sozialer
Kämpfe der vergangenen Jahrzehnte zu verstehen und würde deshalb ein weites
Terrain konkreter Forschung und Politik öffnen, das seinerseits von den
theoretischen Leistungen Holloways profitieren, aber auch diese über
Erkenntnisse und Erfahrungen der jeweils eigenen Untersuchungen wieder
bereichern könnte? Konkreter: Schafft es der neoliberale Kapitalismus nicht
zunehmend, den Fluss des Tuns selbst in Wert zu setzen, die einmal gegen das
Kapitalverhältnis selbst erkämpften Errungenschaften (Autonomie,
Selbständigkeit, Eigenverantwortung, das waren einmal linke Begriffe!) sich
produktiv und Profit bringend anzueignen? Impliziert das nicht andererseits
auch, dass Erkämpftes nie gänzlich im Kapitalverhältnis aufgehen kann, zumindest
nicht sofort? Konstituieren diese vorgängigen Kämpfe nicht doch positive
Anknüpfungspunkte für weitere Auseinandersetzungen, und sei es als Warnungen?
Schreiten wir voran? Hoffentlich nicht: NEIN. Es ist nicht bei einer Frage
geblieben.
E-Mail:
pyrx@gmx.li
Literatur:
Benjamin,
Walter (1965): Geschichtsphilosophische Thesen, in: - ders.: Zur Kritik der
Gewalt und andere Aufsätze. Mit einem Nachwort von Herbert Marcuse, Frankfurt
a.M. 1965, S. 78-94
Dussel, Enrique (2004): Dialogo con John
Holloway (Sobre la
interpelación ética, el poder, las instituciones y la estrategia política),
http://www.afyl.org/holloway.pdf, abgefragt am 24.2.2006
Hardt,
Michael und Negri, Antonio (2003): Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt a.M.
- dies.
(2004): Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, New York
Holloway,
John (2002): Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen, Münster
- ders.
(2004): Aufhören, den Kapitalismus zu machen, in: grundrisse.zeitschrift für
linke theorie & debatte, Nr. 11/2005, Wien, S. 6-12
- ders.
(o.J.): Time to Revolt – Reflections on Empire,
http://libcom.org/library/time-to-revolt-empire-john-holloway, abgefragt am
24.2.2006
Reitter,
Karl (2002): Wo wir stehen.
Überlegungen zu John
Holloways Buch „Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen“, in:
grundrisse. zeitschrift für linke theorie & debatte, Nr. 6/2003, Wien, S. 13-26
Virno, Paolo
(2005): Grammatik der Multitude.
Mit einem
Anhang: Die Engel und der General Intellect, Wien
Wildcat
(1997): Offener Brief an John Holloway.
In: Wildcat-Zirkular
Nr. 39, S. 31-44.
[1]
Die weltweite Debatte um Holloways Buch ist auf der Homepage der
argentinischen Zeitschrift Herramienta dokumentiert:
www.herramienta.com.ar, in den grundrissen findet sich ein längerer Text
von Karl Reitter zu Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen
(Reitter 2002) sowie eine Aufforderung von John Holloway: Stop
making capitalism (Holloway 2004)
[2]
Guido Starosta: Editorial Introduction; Daniel Bensaid: On a Recent Book
by John Holloway; Marcel Stoetzler: On How to Make Adorno Scream, Some
Notes on John Holloway´s Change the World without Taking Power;
Michael A. Lebowitz: Holloway´s Scream: Full of Sound and Fury; Massimo
De Angelis: How?!?! An Essay on John Holloway´s Change the World
without Taking Power; Leigh Binford: Holloway´s Marxism und John
Holloway: No. Die Texte
finden sich in: Historical Materialism. Research in Critical Marxist
Theory, Vol. 13 Issue 4, 2005, S. 161-284. Nur-Seitenzahlen beziehen
sich immer auf diese Sektion. Alle Übersetzungen von mir, MB.
Holloway bezieht sich offensichtlich auf Walter Benjamins
Geschichtsphilosophische Thesen. In der These 15 wird berichtet: „Das
Bewusstsein, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, ist den
revolutionären Klassen im Augenblick ihrer Aktion eigentümlich. [...]
Noch in der Juli-Revolution (von 1830, Anm. MB) hatte sich ein
Zwischenfall zugetragen, in dem dieses Bewusstsein zu seinem Recht
gelangte. Als der Abend des ersten Kampftages gekommen war, ergab es
sich, dass an mehreren Stellen von Paris unabhängig voneinander und
gleichzeitig nach den Turmuhren geschossen wurde“ (Benjamin 1965, 90f.).
[4]
Endgültig absurd wird die Szenerie wenn Holloway als „Beweis” für die
Fehlerhaftigkeit der Aussage am Anfang des Johannesevangeliums (und
Foucaults und ...) die berühmte Stelle aus dem Marxschen Kapital bemüht:
„Was aber von vorneherein den schlechtesten Baumeister vor der besten
Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat,
bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein
Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des
Arbeiters, also schon ideell vorhanden war” (Marx 1965, S. 178, vgl.
Holloway 2002, 36f.). De Angelis weist mit Recht auf die jener Holloways
genau gegenläufiger Intention Marxens hin: ohne „ideelles
Vorhandensein”, ohne Begriff, ohne Wort keine Vorstellung, keine Zelle,
kein Tun (vgl. 240).
[5]
Auch Virno ist das Denken des Einheitlichen nicht fremd, er bestimmt es
auch – wie Holloway – als interne Einheit, die durch „die Sprache, de[n]
Intellekt, die den Menschen gemeinsamen Vermögen“ (Virno 2005, 31)
möglich wird und eben keine äußerliche Instanz wie den Staat braucht. An
anderer Stelle spricht er von der Multitude als Resultat einer
Zentrifugalkraft im Gegensatz zu der das Volk und die Souveränität
herstellenden Zentripetalkraft (Virno 2005, 53).
[6]
Dies wäre jenseits dieser kritischen Anmerkung nicht nur an den
expliziten Bezugnahmen Holloways auf Ernst Bloch und Benjamins
Messianismus (vgl. auch Holloway, o.J.) genauer zu besehen, auch der
Dialog zwischen Holloway und dem Befreiungstheologen und -theoretiker
Enrique Dussel (Dussel 2004) verspricht nicht uninteressante
theoretische Implikationen.
[7]
zur Kritik an der neueren Entwicklung von Holloways Theorie aus
operaistischer Sicht siehe Wildcat (1997).
|
