|

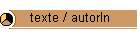

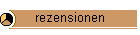



| |
Anton Pam
Kriegskommunismus in Russland und China: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
„Gleicher Arbeitszwang für alle
Mitglieder der Gesellschaft bis zur vollständigen Aufhebung des Privateigentums.
Bildung industrieller Armeen, besonders für die Agrikultur.“
Friedrich Engels in
„Die Grundsätze des Kommunismus“ 1847 (Marx/Engels, Band 1, 1972: S.347f).
Zwei Mal
wurde in der Geschichte der Versuch unternommen, direkt in den Kommunismus
überzugehen: 1919 in Russland und 1958 in China. Auch wenn diese Versuche nicht
einmal ein Jahr dauerten, so hatten sie doch weitreichende Folgen für die
Entwicklung beider Länder und verursachten große Hungersnöte. Unter Kommunismus
verstanden die linken Bolschewiki und die MaoistInnen weniger eine „freie
Assoziation der Produzenten“ als eine komplette Militarisierung der ganzen
Gesellschaft auf dem Boden von staatlichem Eigentum. An dieser Stelle sollen die
beiden Konzeptionen des Kriegskommunismus und der Militarisierung der Arbeit
herausgearbeitet und verglichen werden.
A. China:
„Der Große Sprung nach vorne“ und der direkte Übergang zum Kommunismus
(1958-1961)
Die Militarisierung des Dorfes
Mit dem Beginn
des „Großen Sprungs nach vorne“ rückte das Dorf wieder in den Mittelpunkt der
sozialistischen Umwälzung und die BäuerInnen wurden verstärkt als die Triebkraft
der Revolution gepriesen. Ein Kommentar der „Volkszeitung“ betonte, dass die
BäuerInnen die Grundlage von Armee, ArbeiterInnenklasse und Industrialisierung
seien und unterstrich diese Auffassung mit Mao Zedong-Zitaten aus dem
BürgerInnenkrieg. Die BäuerInnenfrage sei außerdem das grundlegende Problem des
sozialistischen Aufbaus (Volkszeitung 1.7.1958: S.1).
Die große
Arbeitsarmee der BäuerInnen wurde zum Mittel erklärt, China in kürzester Zeit
zur modernen Industrienation zu machen. Die militarisierten Massen sollten mit
ihrem Enthusiasmus früher nie Erreichtes vollbringen. Wu Zhipu, der
Provinzführer von Henan und einer der radikalsten Vertreter des „Großen
Sprungs“, sagte: „Früher glaubten wir, dass es sehr schwierig sei, England zu
überholen. Jetzt können wir in der Stahlproduktion und vielen anderen
Schwerindustriezweigen nächstes Jahr England einholen (...). Wenn 600 Millionen
Menschen Hand anlegen und alle Kräfte anspannen, können wir alles, was wir
wollen, erreichen.(...) Wir müssen nur an die Führung der Kommunistischen Partei
glauben und die Linie der Partei und Regierung durchführen, uns fest auf die
breiten Volksmassen stützen und uns mit der verbündeten Armee der Bauern
zusammenschließen“ (Wu Zhipu 1958: S.7).
Die Bildung der
„Großen Arbeitsarmee“ ging mit der Stahl- und Bewässerungskampagne einher. Im
Dezember betonte das ZK der Partei selbst in der sogenannten Wuhan-Resolution,
die die „Ausrichtung“ der Volkskommune einleitete, noch ein Mal die
Militarisierung der gesamten ländlichen Arbeitskräfte: „Die sogenannte
Militarisierung der Organisation bedeutet auch eine fabrikmäßige Umwandlung,
dies heißt, dass die Arbeitsorganisation der Kommune genauso organisiert und
diszipliniert erfolgen muss wie in den Fabriken und der Armee; das ist in einer
landwirtschaftlichen Produktion großen Maßstabes notwendig (...)”. Das ZK
ordnete die Schaffung einer „landwirtschaftlich industriellen Armee” an (Martin,
Band 3, 1982: S.302). Geschichtlich begründete die Führung: Das Bürgertum habe
die moderne industrielle Armee organisiert und jede Fabrik würde einer Kaserne
gleichen. „Die Strenge der Disziplin des Arbeiters, der an der Maschine steht,
steht der Disziplin in der Armee in nichts nach. Die industrielle Armee in der
Industrie der sozialistischen Gesellschaft ist die industrielle Armee einer
einzigen Klasse, der Arbeiterklasse (...)“. Dieses System würde statt auf
Ausbeutung auf Einsicht und der Freiwilligkeit des demokratischen Zentralismus
beruhen. „Wir wenden nun dieses System auf die ländlichen Gebiete an (...)“
(ebenda: S.301f.).
Die dörfliche
Produktion sollte nach militärischen Prinzipien organisiert werden und eine
fabrikmäßige Disziplin etabliert werden. Militarisiert wurde nicht nur die
Arbeit, sondern auch die Sprache. „Die Arbeitsinstrumente sind Waffen und das
Feld ein Schlachtfeld“ wurde als Parole ausgegeben.
Mit dem
ZK-Beschluss im August zur Einführung der Volksmiliz wurde versucht, die
BäuerInnen auch in SoldatInnen zu verwandeln. Bis 1962 sollten alle Männer und
Frauen zwischen 16 und 50 Jahren, die ein Gewehr tragen konnten und nicht zu den
„schlechten Vier“ gehörten, in den Milizen organisiert werden. Falls der
„imperialistische“ Feind angreifen sollte, würde er im großen Meer der
Volksmiliz ertränkt werden (Jgyl, Band 11, 1995: S.471) In der Broschüre
„Volkskommune und Kommunismus“ wurde sogar behauptet, dass, wenn alle
ChinesInnen zwischen 18 und 40 Jahren in die Miliz eintreten, China mehr
Soldaten als alle Staaten in beiden Weltkriegen zusammen hätte (Wu Ren 1958:
S.27). Eines Tages sollte die Miliz die reguläre Armee ersetzen, was aber noch
längere Zeit brauchen würde (ebenda: S.29). Als weiteres Argument wurde die
Ersparnis von Kosten angeführt. So fügte Mao in seiner persönlichen
Überarbeitung des Statuts der Sputnik-Kommune ein, dass die Volksbewaffnung die
Verteidigungsausgaben reduzieren könne (Mzdwg, Band 7, 1992: S.345).
Die Einführung
der Volksmiliz wurde keinesfalls rein militärisch begründet. Mit dieser neuen
Organisation könne Leben und Arbeit auf dem Dorf militarisiert werden (ebenda:
S.28). Mao Zedong begründete im Gespräch mit JournalistInnen, die Volksmiliz sei
eine Einheit von Produktion, Verteidigung und Erziehung (Mzdwg, Band 7, 1992:
S.430). In der Presse wurde diese Definition immer wieder wiederholt. Die
„Volkszeitung“ berichtete über die Erfahrungen im Produktionsmanagement der
Sputnik-Kommune in Henan und die Einführung von militärischen Rängen und
Strukturen, die erfolgreich zur Durchsetzung einer militärischen Disziplin
beigetragen hätten (Volkszeitung 7.10.1958).
Die Volksmiliz
wurde von der „Roten Fahne“ zur Schule des Kommunismus erhoben (Rote Fahne, Nr.
7, 1.9.1958: S.15). Mitte Oktober hieß es in dem Theorieorgan bezüglich der
Volksbewaffnung: Die kommunistische Erziehung durch die Volksmiliz könne den
neuen ganzheitlichen Menschen schaffen. Selbst ohne äußere Feinde wäre die
Volksmiliz das Instrument zum Krieg gegen die Natur, sowie zur Urbanisierung und
Industrialisierung des Dorfes (Rote Fahne, Nr. 10, 16.10.1958: S.21).
Die Gründung
der Miliz wurde dargestellt, als sei sie das natürliche Bedürfnis der BäuerInnen.
Auch wenn die BäuerInnen die Forderung von Marx und Engels aus dem „Manifest der
Kommunistischen Partei“
nicht kennen würden, so neigten sie aus den Erfahrungen des Bürgerkrieges zur
Militarisierung (Rote Fahne, Nr. 7, 1.9.1958: S.13). Ein Krieg gegen Japan, die
USA oder die Natur könne auf gleiche Weise geführt werden (Volkszeitung,
30.9.1958: S.2).
Franz Schurmann
ist einer der wenigen AutorInnen, die die zentrale Bedeutung der Militarisierung
im Programm des „Großen Sprungs“ erkannt haben.
Er schreibt
über die Ideologie der Bewegung: „Three years of suffering would be followed by
thousand years of happiness, the peasant was told. If the ideal of communism was
the pure ideology of communism, its practical ideology was militarization. The
methodology of the revolution was the militarization of the peasantry” (Schurmann
1968: S.480).
Die zentralen
Fragen, die im Herbst 1958 im Zusammenhang mit dem Übergang zum Kommunismus
diskutiert worden sind, waren:
-
Die Überführung des kollektiven Eigentums der BäuerInnen und der Parzellen zur
privaten Nutzung in das Eigentum des ganzen Volkes.
-
Die Ersetzung der Entlohnung nach Leistung und Naturalien durch ein Lohnsystem,
was den schrittweisen Übergang zum Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder
nach seinen Bedürfnissen“ möglich machen sollte.
-
Die Einführung einer Rundum-Versorgung in den Volkskommunen (Kindergärten,
Volksküchen, Altenheime, Zuteilung von Kleidung und Gebrauchsgegenständen usw.).
Die Frage des
Absterbens des Staates spielte eher eine untergeordnete Rolle und wurde nur am
Rande erwähnt.
Mao sah wie
Stalin in der Transformation der Eigentumsverhältnisse zu immer höheren Stufen
des Eigentums den Weg zum Kommunismus. Er wollte dies mit Hilfe von
unterunterbrochenen Massenbewegungen erreichen (Martin, Band 3, 1982: S.24).
Mao setzte sich
mit Stalins These zu den Voraussetzungen zur Verwirklichung des Kommunismus im
November 1958 auseinander. Bei Stalins Punkten würde das Prinzip „Die Politik
hat das Kommando“, die Massenbewegungen, „Die ganze Partei und das ganze Volk
betreibt Industrie, Landwirtschaft, Kultur und Erziehung“, die
Ausrichtungsbewegungen und der Kampf zur schrittweisen Abschaffung des
bürgerlichen Rechts fehlen. Mit der Volkskommune sei das Problem des Übergangs
relativ leicht zu lösen (Mzdwg, Band 7, 1992: S.596f.).
Der Beschluss
des ZK zur Gründung der ländlichen Volkskommunen vom 29.8.1958 besagte, dass der
Kommunismus keine Sache der fernen Zukunft sei (Jgyl, Band 11, 1995: S.450). Der
Beschluss legte fest, dass die Frage der Parzellen und privaten Bäume nicht
übereilt geregelt werden sollte und auch später wieder neu bestimmt werden
konnte. Im Allgemeinen sollten die Parzellen zur privaten Nutzung in die
kollektive Bewirtschaftung übernommen werden. Die Bäume der BäuerInnen durften
vorerst privat bleiben. Wenn sich die Produktion gut entwickle und sich die
Einkommen erhöhten, würden die Bäume nach ein bis zwei Jahren automatisch
Kollektiveigentum werden. Den Übergang vom Kollektiv- zum Volkseigentum könnten
einige Orte in drei bis vier Jahren vollziehen. Andere würden fünf bis sechs
Jahre oder länger brauchen. Das Volkseigentum würde dann noch sozialistischen
Charakter haben (ebenda: S.449). Der Beschluss unterstrich, dass die Verteilung
nach der Arbeitsleistung, also nach bürgerlichem Recht, noch erhalten bleiben
sollte.
Dieser
Beschluss zur Volkskommune, der auf der Beidaihe-Konferenz verabschiedet wurde,
war im Vergleich zur Politik der folgenden zwei Monate noch relativ gemäßigt,
beweist aber auch, dass die Übergabe der Parzellen zur privaten Nutzung an die
Kommune die Politik der Zentralregierung war. Das Kollektiveigentum sollte zwar
nicht sofort in Volkseigentum verwandelt werden, aber drei bis vier Jahre waren
für die völlige Vernichtung des kollektiven und privaten Eigentums sicher eine
sehr kurze Zeit. In diesem Beschluss wurde die Volkskommune als kollektives
Eigentum definiert, die aber auch Faktoren des gesellschaftlichen Eigentums in
sich tragen würde (Volkszeitung 4.9.1958).
Die Politik
radikalisierte sich im Laufe des Septembers. Die Einführung der Volksküchen war,
wie schon erwähnt, ein willkommener Anlass, die Parzellen zur privaten Nutzung
für überflüssig zu erklären (Rote Fahne, Nr. 7: S.23 und Volkszeitung, 3.9.1958:
S.3). In der offiziellen Broschüre „Die Volkskommune und der Kommunismus“ von
Oktober 1958 schrieb Wu Ren, dass mit der Einführung der Volkskommune die
Parzellen zur privaten Nutzung, das private Vieh und die Haustiere sowie die
privaten Bäume nun nicht mehr geschützt werden müssten und sie der Kommune
übergeben werden könnten. Damit wäre das Privateigentum an Produktionsmittel
entgültig abgeschafft (Wu Ren 1958: S.2). Die Volkskommune würde das alte Ideal
der Vorfahren „Alles unter dem Himmel wird öffentlich“ verwirklichen (ebenda:
S.11).
Außerdem wurden
die Modell-Kommunen in Henan und Hebei, von denen z.B. Xushui plante, 1963 in
den Kommunismus einzutreten, in der Presse gefeiert. Das Statut der
Sputnik-Kommune von Chayashan in der Provinz Henan wurde am 1.9. in der „Roten
Fahne“ und am 4.9. in der „Volkszeitung“ veröffentlicht. Im Artikel 5 des
Statuts hieß es: „Da die Produktionsmittel in das Eigentum der Kommune
übergehen, sollen die der Kommune beitretenden Mitglieder ihr gesamtes privates
Hofland, eigene Häuser, Äcker, Vieh und Obstbäume in das Eigentum der Kommune
überführen; sie können jedoch einen kleinen Bestand an Haustieren und Geflügel
als Privatbesitz behalten“ (GNN 1988: S.33). Die Kommunisierung der Häuser und
auch der Sparguthaben war der nächste Schritt in der Umwälzung der
Eigentumsverhältnisse.
Der Kommentar
der „Volkszeitung“ zur Veröffentlichung des Statuts unterstrich den
Vorbildcharakter von Chayashan für die Gründung von Volkskommunen, betonte aber
auch, dass das Modell nicht zwangsweise überall kopiert werden sollte
(Volkszeitung 4.9.1958: S.1). Der Provinzführer von Henan, Wu Zhipu, verkündete,
dass die Bildung der Volkskommunen die Abschaffung des Privateigentums und
Vernichtung der drei Unterschiede sowie die Industrialisierung des Dorfes
bedeute (Rote Fahne, Nr.8. 16.9.1958: S.5-11). Schon am 2. September berichtete
die „Volkszeitung“ von der vollständigen Volkskommunisierung in Henan und
erwähnte meines Wissens zum ersten Mal öffentlich den baldigen Übergang zum
Kommunismus (Volkszeitung 2.9.1958: S.1). Durch die Propagierung des Henaner
Modells als nationales Vorbild und die Besuche führender Politiker in diesen
Kommunen trieb die Zentralregierung die Umwälzung in Richtung Kommunismus aktiv
voran.
Wie oben
erwähnt, unterstrich das Statut der Sputnik-Kommune noch die Verteilung nach
Leistung, sprich das „bürgerliche Recht“. Unter „bürgerlichem Recht“ verstanden
die chinesischen Kommunisten damals die Entlohnung der Arbeit nach Leistung. Im
Herbst fand in der „Volkszeitung“ eine ausführliche Debatte zum
Verteilungssystem statt. Sollten die Kommunen nun zur Verteilung nach den
Bedürfnissen übergehen? In welchem Verhältnis sollte ein festgesetzter Geldlohn
zur Verteilung von Naturalien stehen? Wie konnte man das Prinzip der Verteilung
nach Leistung und mit den „Keimen des Kommunismus“, sprich einer Verteilung nach
den Bedürfnissen, kombinieren?
Für die
chinesischen KommunistInnen war Lenins Kritik des „bürgerlichen Rechts“ von
zentraler Bedeutung. Auf die Passagen in „Staat und Revolution“ wurde mehrfach
Bezug genommen (Volkszeitung, 10.1.1958: S.11). Die „Volkszeitung“ berichtete
über „Keime des Kommunismus“ in Henan, wo ein Zuteilungssystem von Getreide plus
Lohn verwirklicht und aus den BäuerInnen angeblich landwirtschaftliche
ArbeiterInnen wurden. Besonders bemerkenswert sind die Argumente gegen das
System der Arbeitspunkte: Die Festlegung der Arbeitspunkte nach Leistung sei
eine zu große Zeitverschwendung und ihre Abschaffung habe zur Erhöhung der
Produktivität geführt (Volkszeitung, 29.9.1958: S.3). Wieder wird hier die
Abschaffung des Leistungsprinzips mit ökonomischer Rationalität begründet, auch
die „Rote Fahne“ behauptete, dass die Abschaffung de Leistungsprinzips
Arbeitseifer frei setzten würde (Rote Fahne, Nr. 10: S.5).
Neben der
Rationalität gab es aber auch eine andere Argumentationslinie gegen das Prinzip
der Arbeitspunkte. Zhang Chunqiao, das spätere Mitglied der „Vierer-Bande“,
schrieb einen wichtigen Artikel zur Kritik des „bürgerlichen Rechts“
(Volkszeitung 13.10.1958: S.7). Er begründete die Abschaffung des „bürgerlichen
Rechts“ mit der PartisanInnentradition von Jinggangshan. Dort hätte es ein
kommunistisches Verteilungssystem gegeben, in dem Soldaten und ZivilistInnen,
sowie Offiziere gemeinsam und gleichberechtigt das „bittere“ Leben
durchgestanden hätten. Nach der Befreiung dauerte es nicht lange, bis dieses
System unter Beschuss durch die bürgerliche Ideologie geraten und als
„Partisanenstil“ angegriffen worden wäre. Diese Kritik sei in Wahrheit eine
Verteidigung des „bürgerlichen Rechts“. Zhang bezog sich auf die von Mao in dem
Artikel „Der Kampf im Jinggang-Gebirge“ beschriebene Leidensgemeinschaft. „In
der Roten Armee gibt es bis jetzt keine reguläre Auszahlung von Sold, es werden
nur Getreide, Geld für Speiseöl, Salz, Brennholz und Gemüse sowie eine geringe
Summe als Taschengeld gewährt. Alle Offiziere und Soldaten der Roten Armee, die
im Grenzgebiet ansässig sind, haben Boden zugeteilt erhalten“ (Mao Zedong, Band
1, 1968: S.89). Neben diesem Artikel bezog sich Zhang noch positiv auf die
Pariser Kommune von 1871, die gleiche Löhne für ArbeiterInnen und BeamtInnen
eingeführt hatte.
Mao Zedong
schrieb in einem Brief, dass der Artikel von Zhang Chunqiao im Prinzip korrekt
sei, aber ein bisschen einseitig (Mzdwg, Band 7, 1992: S.447). Warum er ihn
einseitig fand, erwähnte er jedoch nicht. Auf der Beidaihe-Konferenz machte Mao
längere Ausführungen zur PartisanInnentradition. Leider ist diese Rede bis heute
nicht veröffentlicht worden und wir haben nur eine Zusammenfassung von Maos
damaligen Sekretär Li Rui. „Unser Kommunismus wurde zuerst von der Armee
hervorgebracht“, verteidigte Mao den „Partisanenstil“ (Li Rui, Band 2, 1999:
S.123). Während des über zwanzigjährigen Krieges hätte die KPCh einen
Kriegskommunismus praktiziert, wo es keinen Lohn gab und man sich selbst mit
Getreide versorgen musste. Die KritikerInnen würden behaupten, dass diese
Gleichmacherei FaulenzerInnen hervorbringen würde. Mao erwiderte, dass er in den
vergangenen 22 Jahren nicht viele FaulenzerInnen gesehen hätte. Der Grund dafür
sei, dass die Politik den Oberbefehl und man ein gemeinsames Ziel im
Klassenkampf habe. Mit dem Versorgungssystem und dem kommunistischen Lebensstill
hätte die KPCh den Krieg gewonnen, warum könne man so den Kommunismus nicht
einführen und müsse unbedingt ein Lohnsystem haben (ebenda: S.105)? Der Schritt
zurück zum Verteilungssystem der Armee sei in Wirklichkeit ein Schritt nach
vorne, mit dem 600 Millionen Menschen den kommunistischen Stil praktizieren
könnten (ebenda: S.106).
An dieser
Debatte wird deutlich, dass Zhang Chunqiao und auch Mao Zedong ganz anders als
Lenin gegen das „bürgerliche Recht“ argumentierten. Für Lenin war es ein
notwendiges Muttermal, was der Sozialismus unvermeidbar zu tragen hatte. Erst
wenn die Gesellschaft rationell wie eine Fabrik organisiert und ihre Mitglieder
zu freiwilliger Arbeit und Verwaltung in der Lage seien, könne das
Leistungsprinzip durch eine Verteilung nach den Bedürfnissen ersetzt werden.
Zhang meinte nicht, dass eine enorme Steigerung der Produktion für diesen
Prozess von Nöten sei, sondern plädierte gesamtgesellschaftlich für die Rückkehr
zum Versorgungssystem der Armee im Bürgerkrieg. Was an diesem Versorgungssystem
kommunistisch sein soll, ist mir völlig schleierhaft. Wie aus dem Zitat von Mao
hervorgeht, handelte es sich dabei keineswegs um eine Verteilung nach den
Bedürfnissen der Menschen, sondern nur um eine Garantie des Minimalbedarfs. So
stellt sich die Frage, was die chinesischen Kommunisten unter Bedürfnissen
verstanden, wenn in China von 1958 von den „Keimen des Kommunismus“ im
Verteilungssystem gesprochen wird. Was war an einem staatlichen Zuteilungssystem
generell kommunistisch? Viele kapitalistische Staaten führten im 1. und
2.Weltkrieg zur Versorgung der Armee und Bevölkerung eine strenge
Lebensmittelrationierung ein.
B. Russland:
Kriegskommunismus und Bürgerkrieg (1918-1921)
Wenn man den
„Großen Sprung nach vorne“ auch als Kriegskommunismus betrachtet, bietet sich
der Vergleich zum bolschewistischen Russland an, weil die Debatte um die
Erziehung aller Menschen zur Arbeit sowie die Militarisierung der Arbeit nach
der Oktoberrevolution von 1917 offen geführt wurde.
Trotzki:
Militarisierung und Arbeitszwang
Leo Trotzki
entwickelte in der Auseinandersetzung mit dem deutschen Sozialdemokraten Karl
Kautsky eine theoretische Rechtfertigung für die Militarisierung der Arbeit. Zu
Beginn der 20er Jahre lehnte die Mehrheit der Parteiführung Trotzkis Forderung
nach der Militarisierung der Gewerkschaften ab und Lenin kritisierte diese
Konzeption mehrfach (Lenin, Band 32, 1988: S.1-26).
Trotzki legte
gegenüber Kautsky dar, dass in Russland die Diktatur des Proletariats herrsche
und die Diktatur der Räte nur durch die Herrschaft der kommunistischen Partei
verwirklicht werden könne (Trotzki 1920: S.88). Dass der Mensch ein „Faultier“
sei (ebenda: 1920, S.109), war Trotzkis Rechtfertigung für die systematische
Verwirklichung der Arbeitspflicht und des Prinzips „Wer nicht arbeitet, soll
auch nicht essen“ (ebenda: S.111). In der damaligen Sowjetverfassung war dieser
Grundsatz (§ 18, Absatz 2) schon verankert.
Trotzki wies
den Vorwurf zurück, dass Zwangsarbeit und Leibeigenschaft generell unproduktiv,
sondern dass sie zur Zeit ihrer Einführung sogar ein Fortschritt gewesen sei
(ebenda: S.119). Aus seinen Prämissen machte Trotzki eine ganze
Geschichtstheorie: „Die ganze Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der
Organisierung und Erziehung des kollektiven Menschen der Arbeit, zwecks
Erzielung einer höheren Produktivität“ (ebenda: S.120).
Die beste
Methode dafür sei im Sozialismus die Militarisierung der Arbeitskräfte. Die
Grundlage für die Militarisierung seien Registrierung, Mobilmachung, Formierung
der Arbeitskräfte, sowie der Transport großer Massen (ebenda: S.111). So könne
man eine mobile Arbeitsarmee schaffen. Der proletarische Staat sei, wie die
Armee, in der Lage seine BürgerInnen unterzuordnen: „Warum sprechen wir von
Militarisierung? (...) Keine andere gesellschaftliche Organisation mit Ausnahme
der Armee hat sich berechtigt gehalten, sich die Bürger in solchem Grade
unterzuordnen, sie in solchem Maße von allen Seiten durch ihren Willen zu
umfassen, wie dies der Staat der proletarischen Diktatur tut und zu tun sich für
berechtigt hält“ (ebenda: S.116).
Zwar befand
sich das rote Russland 1920 noch im Bürgerkrieg und die Bolschewiki kämpften ums
Überleben, doch machte Trotzki deutlich, dass es sich bei der Militarisierung
der Arbeit keineswegs nur um eine Notwendigkeit des Bürgerkrieges handelte,
sondern die unvermeidliche Methode zur Organisation und Disziplinierung der
Arbeitskraft beim Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus (ebenda: S.118). Die
guten Arbeiter sollten mit einem höheren Lebensstandard belohnt und die
schlechten bestraft werden.
„Man muss den
Arbeitern sagen, wo sie sein müssen, sie umstellen und leiten wie Soldaten
(...), der Zwang zur Arbeit wird seinen höchsten Grad während des Übergangs des
Kapitalismus zum Sozialismus erreichen (...), die ‚Fahnenflüchtigen’ der Arbeit
werden in Disziplinierungsbataillone eingeordnet oder in Konzentrationslager
gesteckt werden müssen“ (zit. nach Bettelheim 1975: S.321).
Auf die Frage
eines Kritikers, worin sich dieser Sozialismus von der ägyptischen Sklaverei
unterscheide, antwortete Trotzki: durch den Klassencharakter (Trotzki 1920:
S.142). Die Form der Organisation der Arbeit hielt er wohl nicht für
unterschiedlich. Das Zwangsregime wurde damit begründet, dass die Interessen der
Arbeiter und des Staates identisch seien und es sich daher um Selbstdisziplin
handle.
Die
Militarisierung der Arbeit wurde in Russland 1920 in einigen Bereichen
eingeführt, aber nach kurzer Zeit, auch wegen Lenins Widerstand, wieder
abgeschafft.
Lenin: Dem barbarischen Russland das Arbeiten beibringen
Lenin lehnte
Trotzkis Forderungen nach der Militarisierung der Arbeit ab, entwickelte 1918
aber selbst ein Programm für die „Zivilisierung“ Russlands und die Durchsetzung
einer neuen industriellen Arbeitsdisziplin. Lenins Positionen waren gemäßigter
als das Parteiprogramm der KPR von 1919 (Pipes, Band 2, 1992: S.568). Er wollte
vom deutschen Staatskapitalismus, sprich der deutschen Kriegswirtschaft im
1.Weltkrieg, lernen, die die Produktion unter die Leitung des Staates stellte
und den Arbeitszwang einführte. In seiner Schrift „Über die Naturalsteuer“, die
die Einführung der NEP begründete, zitierte Lenin aus seiner Schrift von 1918:
„Wenn in Deutschland die Revolution noch in ihrer ‚Geburt’ säumt, ist es unsere
Aufgabe, vom Staatskapitalismus der Deutschen zu lernen, ihn mit aller Kraft zu
übernehmen, keine diktatorischen Methoden zu scheuen, um diese Übernahme der
westlichen Kultur durch das barbarische Russland noch stärker zu beschleunigen,
ohne dabei vor barbarischen Methoden des Kampfes gegen die Barbarei
zurückzuschrecken“ (Lenin, Band 3, 1984: S.672). Der russische Mensch sei ein
schlechter Arbeiter im Vergleich zu den „fortschrittlichen“ Nationen und müsse
nun mit Hilfe der Sowjetmacht arbeiten lernen (Lenin, Band 2, 1984: S.753).
Bezogen auf die
Organisation der Arbeit bedeutete Lenins „Zivilisierungsprogramm“, die
industrielle Disziplin des Fabrikproletariats auf alle Gesellschaftsmitglieder
zu übertragen und vor allem die Bauernschaft zu erziehen, schulen und
disziplinieren (Lenin, Band 31, 1959: S.164). Lenin fasst den Begriff der
ArbeiterInnenklasse in Russland sehr eng, um sie vom Landproletariat und gerade
erst proletarisierten BäuerInnen abzugrenzen. Für ihn gehörten nur die
ArbeiterInnen der industriellen Großbetriebe zum Proletariat und nicht alle
freien LohnarbeiterInnen. Nur die städtischen IndustriearbeiterInnen seien in
der Lage, die Masse der Werktätigen zu führen (Lenin, Band 3, 1984: S.254) und
eine neue Arbeitsdisziplin durchzusetzen. „Diese neue Disziplin fällt nicht vom
Himmel (...), sie erwächst aus den materiellen Bedingungen der kapitalistischen
Großproduktion und nur aus ihnen“ (ebenda: S.254).
In den
Schriften „Wie man den Wettbewerb organisieren soll“ (1917), „Die nächsten
Aufgaben der Sowjetmacht“ (1918) und „Die große Initiative“ (1919) führte er
sein „Zivilisierungsprogramm“ zur Erziehung zur Arbeit näher aus. Das Prinzip
„Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“ müsse zum praktischen Gebot des
Sozialismus werden (Lenin, Band 2, 1984: S.593f.). Um Kontrolle, wirtschaftliche
Rechnungsführung und einen Wettbewerb in den Betrieben einzuführen, bedürfe es
einer „Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer“. An machen Orten
solle man Reiche, Gauner und ArbeiterInnen, die sich vor der Arbeit drückten,
wie die Setzer in Petrograd, ins Gefängnis stecken und an anderen Orten Klosetts
reinigen lassen. „An einem dritten Ort wird man ihnen nach Abbüßung ihrer
Freiheitsstrafe gelbe Pässe aushändigen, damit das ganze Volk sie bis zu ihrer
Besserung als schädliche Elemente überwache. An einem vierten Ort wird man einen
von zehn, die sich des Parasitentums schuldig machen, auf der Stelle erschießen“
(ebenda: S.594), schrieb Lenin im Dezember 1917, noch vor dem Ausbruch des
Bürgerkrieges. Zur Steigerung der Produktivität empfahl Lenin außerdem die
Einführung des Stücklohns und die Übernahme der fortschrittlichen und
wissenschaftlichen Elemente des Taylor-Systems (ebenda: S.753). Außerdem sollte
das Kulturniveau des Volkes durch eine Alphabetisierung erhöht werden.
Neben diesen
Elementen des Zwangs hoffte Lenin, der selbstlose Arbeitseifer der
IndustriearbeiterInnen an der Heimatfront könne sich auf die ganze Gesellschaft
übertragen. Die Subotniks, Samstage an denen ArbeiterInnen unbezahlt und
freiwillig arbeiteten, waren für Lenin die Vorboten der kommunistischen Arbeit.
„Der Kommunismus beginnt dort, wo einfache ArbeiterInnen in selbstloser Weise,
harte Arbeit bewältigend, sich Sorgen machen um die Erhöhung der
Arbeitsproduktivität, um den Schutz eines jeden Puds Getreide, Kohle, Eisen und
andere Produkte, die nicht den Arbeitenden persönlich und nicht den ihnen
‚Nahestehenden’ zu gute kommen, sondern ‚Fernstehenden’, d.h. der ganzen
Gesellschaft (...) (Lenin, Band 3, 1984: S.261).
Wie die
chinesischen KommunistInnenen während des „Großen Sprungs“, trat Lenin für eine
Mischung aus Repressionen, Zwang und Appellen zur freiwilligen und selbstloser
Arbeit ein, um die neue Arbeitsdisziplin und Sparsamkeit von jedem Pud Getreide
zu verankern. Wie sollten sich bei den ArbeiterInnen und BäuerInnen eine
freiwillige und selbstlose Arbeitsdisziplin entwickeln, wenn täglich mit
Repressionen bedroht wurde und selbst die, die arbeiteten, nicht genug zu Essen
hatten. Die Umerziehung der Menschen durch Arbeit beschränkte sich in beiden
Ländern keinesfalls auf die Arbeitslager (Gulag und Laogai), sondern betraf alle
Mitglieder der Gesellschaft. Unbezahlter Einsatz von Arbeitskräften sollte in
beiden Ländern zu einer wichtigen Quelle des sozialistischen Aufbaus werden.
Die
Unterschiede zwischen den Programmen von Lenin, Trotzki und den chinesischen
KommunistInnen waren jedoch gravierend. Während Trotzki die Militarisierung der
ArbeiterInnenklasse und Gewerkschaften forderte, militarisiert die KP China 1958
die BäuerInnen für Masseneinsätze. Dass sich die Arbeitsorganisation 1958 in der
Industrie grundlegend geändert hätte, ist mir nicht bekannt. Die Repressionen
gegen „Deserteure der Arbeit“ wurden in China nicht so offen wie in Russland in
Presse und Broschüren dargelegt. Trotzki sah wie die KP China in der
Organisation der Armee ein Vorbild für jene der Arbeit. Die Militarisierung und
Einführung der Volkskommune ging in China einher mit der Verteidigung des
„Partisanenstils“ und des „ländlichen Arbeitsstils“ sowie der Traditionen von
Yenan und Jinggangshan.
Die
Großproduktion der Industrie schafft deshalb eine neue Arbeitsdisziplin, weil
die Maschinen den Rhythmus diktieren und eine sekundengenaue Abstimmung der
Arbeit von Hunderten von ArbeiterInnen notwendig machen. In China gab es auf dem
Land 1958 nur wenige Maschinen und erst der „Großen Sprung“ setzte die
Mechanisierung offensiv auf die Tagesordnung. Auch wenn die Resolution von Wuhan
im Dezember, ähnlich wie Lenin, von der Übertragung der Disziplin der
IndustriearbeiterInnen auf die ganze Gesellschaft sprach, so waren die
Bedingungen dafür gar nicht vorhanden. Mit den Kampagnen zur Verbesserung der
Bewässerungssysteme, Straßenbau und Tiefpflügen der Felder setzte die Partei auf
traditionelle Formen der Masseneinsätze der BäuerInnen, ohne allerdings auf die
Erntezeiten und die Landwirtschaft genügend Rücksicht zu nehmen. Da wohl weder
durch die kleinen Hinterhof-Hochhöfen noch durch Wasserpumpen eine industrielle
Arbeitsdisziplin auf dem Dorf etabliert werden konnte, setzten die chinesischen
Kommunisten auf die Volksmiliz, um die BäuerInnen zu erziehen, disziplinieren
und mobilisieren. In Maos Zivilisierungskonzept zur Erziehung zur Arbeit
ersetzte die Volksmiliz das industrielle Proletariat.
Lenin wusste,
dass die junge Sowjetmacht in den Fabriken ohne die „bürgerlichen“ ExpertInnen
unmöglich auskommen konnte. In China wurden im Herbst 1958 die
ParteisekretärInnen plötzlich zu den Oberkommandierenden der Produktion, obwohl
viele von Landwirtschaft nicht viel verstanden oder wider besseren Wissens die
völlig unrealistischen Planvorgaben von oben umsetzen mussten. Durch die
Militarisierung war jede Kritik von Seiten der BäuerInnen eine
Befehlsverweigerung. Schon mit der Resolution von Wuhan strukturierte die KPCh
im Dezember das Verhältnis von Miliz und Produktionsbrigaden neu. Auch wenn
weiter die Militarisierung der Arbeit gefordert und die Volksmiliz gefeiert
wurde, sollten von nun an die Führungsorgane von Miliz und Produktionsbrigaden
getrennt werden. Die Vorgesetzten der einzelnen Abteilungen der Miliz sollten
nicht auch noch die Leitung der Kommune oder Produktionsgruppe ausüben (Martin,
Band 3, 1982: S.302).
Um zu prüfen,
ob die Verwendung des Begriffs Kriegskommunismus sinnvoll ist oder nicht, muss
zunächst seine Entstehungsgeschichte untersucht werden. Die Phase des russischen
Bürgerkrieges von 1918 bis 1921 wird in der Historiographie als
„Kriegskommunismus“ bezeichnet. Lenin und die russischen KommunistInnen
verwendeten diesen Begriff erst im Nachhinein. Er tauchte erstmals in
offiziellen Quellen im Frühjahr 1921 auf (Pipes, Band 2, 1992: S.557), als Lenin
und die Partei die „Neue Ökonomische Politik“ (NÖP) formulierten, die den
privaten Handel der BäuerInnen wieder zuließ und sogar entwickeln wollte. In der
Forschung gibt es einen alten Streit, ob es sich bei der Politik des
„Kriegskommunismus“ um eine Notwendigkeit des Bürgerkrieges handelte oder eine
bewusste Strategie für den direkten Übergang zum Kommunismus.
Lenin
definierte den Begriff zu Beginn der NÖP wie folgt: „Der eigenartige
‚Kriegskommunismus’ bestand darin, dass wir faktisch von den Bauern alle
Überschüsse, ja mitunter nicht nur die Überschüsse, sondern auch einen Teil der
für die BäuerInnen notwendigen Lebensmittel einzogen, um den Bedarf der Armee
und den Unterhalt der Arbeiter zu decken. Wir nahmen sie größtenteils auf
Kredit, gegen Papiergeld. Anders hätten wir in dem ruinierten kleinbäuerlichen
Land über Gutsbesitzer und Kapitalisten nicht siegen können“ (Lenin, Band 3,
1984: S.680). Der „Kriegskommunismus“ sei kein Verschulden, sondern ein
Verdienst der Partei gewesen. Nun müsse man aber zur Politik des Austausches von
Getreide gegen Industrieprodukte übergehen. Auf dem 10.Parteitag März 1921
betonte Lenin noch einmal, dass die Partei während des Bürgerkrieges keine
andere Wahl gehabt hätte (Lenin, Band 32, 1988: S.174). Die gleiche Auffassung
geht in den 30er Jahren auch in die kanonisierte Geschichtsschreibung und in den
berühmt-berüchtigten „Kurzen Lehrgang“ zur Geschichte der KPdSU (B) von 1938
ein, den die KommunistInnen auf der ganzen Welt lasen. Der „Kriegskommunismus“
sei durch Krieg und Intervention erzwungen wurden (KAP, 1972: S.301) und nach
Beendigung des Krieges hätte es keinen Grund für dieses harte Regime mehr
gegeben (ebenda: S.303).
Trotzki legte
1936 eine ganz andere Interpretation vor. Er zog historischen Parallelen zum
„Kriegssozialismus“ (Deutschlands) im 1.Weltkrieg, den er als „ein System zur
Reglementierung des Verbrauchs in einer belagerten Festung“ definierte (Trotzki
1979: S.25). Er räumte aber ein: „Man muss jedoch zugeben, dass er in seiner
ursprünglichen Absicht breitere Ziele verfolgte (...). Mit anderen Worten: vom
‚Kriegskommunismus’ gedachte sie (die Sowjetregierung, Anm. A.P.) allmählich,
aber ohne das System zu verletzten, zum echten Kommunismus überzugehen“ (ebenda:
S.25). Dieser theoretische Fehler sei vor dem Hintergrund der Erwartung auf den
Sieg der sozialistischen Revolution im Westen begangen worden (ebenda: S.26).
Leo Kritzmann,
einer der führenden Wirtschaftsexperten in den ersten Jahren nach der
Oktoberrevolution, schrieb 1924 mit dem Buch „Die heroische Periode der großen
russischen Revolution“ eine ausführliche Analyse des „Kriegskommunismus“. Auch
für ihn brachte es der Bürgerkrieg mit sich, dass alles den Bedürfnissen der
Versorgung der Armee untergeordnet werden musste, obwohl die unproduktive
militärische Konsumption zum massiven Rückgang der Produktivkräfte führte (Kritzmann
1971: S.262). Diese „unvermeidlichen Kosten“ wären aber auch verursacht worden,
weil proletarische und bürgerliche Revolution im Oktober 1917 zusammenfielen
(ebenda: S.259). Die Bolschewiki konnten in der Stadt die Industrie
verstaatlichen, mussten aber auf dem Land die Revolution der BäuerInnen
akzeptieren, die ein Meer von KleinproduzentInnen auf staatlichem Boden
schaffte. Dieser Widerspruch zwischen industriellem Großbetrieb und bäuerlichem
Kleinbetrieb machte laut Kritzmann die Getreiderequisitionen notwendig, für die
der Staat keine Gegenleistung erbringen konnte. So musste die „proletarische
Naturalwirtschaft“ den Kleinbetrieb zwangsweise einbeziehen und behinderte damit
seine Entwicklung (ebenda: S.261).
In der heutigen
westlichen Geschichtsschreibung wird die pragmatische Erklärung,
„Kriegskommunismus“ als Notwendigkeit des Bürgerkrieges, überwiegend abgelehnt.
Der Oxford-Professor Orlando Figes hält sie für schwach (Figes 1998: S.649). Der
„Kriegskommunismus“ habe auch den Bürgerkrieg hervorgebracht und sei ein Mittel
des Kampfes gegen die inneren Feinde gewesen. Viele radikale Maßnahmen hätten
der Kampfkraft der Armee und der Wirtschaft eher geschadet als genutzt. Die
Einführung des „Kriegskommunismus“ 1918 sei eine Reaktion auf die Hungerkrise
der Städte gewesen (ebenda: S.650). Die Bolschewiki waren sich der Tatsache
bewusst, dass sie ihre Machtbasis in den Städten und der Arbeiterklasse nicht
verlieren durften. Wenn die Revolution nicht am Hunger zu Grunde gehen wollte,
musste sie ihre Macht auf das Land ausdehnen und den BäuerInnen gewaltsam das
Getreide abnehmen (ebenda: S.651). Generell sieht Figes im „Kriegskommunismus“
einen Prototyp der stalinistischen Wirtschaftpolitik, die jeden privaten Handel
abschaffen, die gesamte Großindustrie verstaatlichen und die Landwirtschaft
kollektivieren wollte (ebenda: S.648).
Pipes hält der
Erklärung von der Notwendigkeit durch den Bürgerkrieg entgegen, dass die
vollentwickelte Form des „Kriegskommunismus“ erst im Winter 1920/21 etabliert
worden sei (Pipes, Band 2, 1992: S.559f.), als die Hauptschlachten des
BürgerInnenkriegs schon geschlagen waren. Die Maßnahmen zur Liquidierung des
Handels und der schrittweisen Ausschaltung des Geldes als Tausch- und
Zahlungssystem durch systematische Geldentwertung konnte man kaum mit dem
Bürgerkrieg begründen.
Dass es sich
beim „Kriegskommunismus“ keinesfalls nur um eine Reaktion auf den Bürgerkrieg
handelte, zeigt auch das neue Parteiprogramm der KP Russland von 1919. Um einen
Vergleich mit der Politik der KP China von 1958 zu ziehen, müssen dieses
Programm und auch die Maßnahmen und Beschlüsse der Sowjetregierung genauer
betrachtet werden.
Der
„Kriegskommunismus“ war nicht nur eine Versorgungsdiktatur zum Unterhalt der
Armee, sondern auch eine radikale Umwälzung der Eigentumsverhältnisse und des
wirtschaftlichen Austausches. Das Programm kündigt die Organisation einer
sozialistischen Landwirtschaft durch Staatshilfen an. Der Handel sollte durch
staatliche Verteilung ersetzt und alle Bürger des Staates in Verbraucherkommunen
organisiert werden. Langfristig plante die Partei Banken durch eine
„Zentralbuchhaltung der kommunistischen Gesellschaft“ zu ersetzen. Anstelle von
Geld sollten dann Schecks und Notenscheine u.s.w verwendet werden. Außerdem
wurde die Massenumsiedlung von Arbeitern aus den Vorstädten in die Häuser des
Bürgertums gefordert. Kleinbetriebe sollten vorerst nur unter die Kontrolle des
Staates gestellt werden.
Die
russischen KommunistInnen wollten ein Netz von Kinderkrippen zur Befreiung der
Frau schaffen, sowie alle Schüler auf Kosten des Staates mit Kleidung und
Nahrung versorgen.
Den
Religionen wurde der Kampf angesagt und Umerziehung der alten Klassen durch
Arbeit sowie die Annäherung von Hand- und Kopfarbeit gefordert. Dieses Programm
radikalisierte sich in der Praxis noch weiter.
Die zentralen
Maßnahmen des „Kriegskommunismus“ sollen hier kurz umrissen werden:
Schon im Mai
1918 führte die Sowjetregierung die Ernährungsdiktatur ein. Der Staat konnte auf
Kredit oder ohne Gegenleistung die Überschüsse der BäuerInnen zur Versorgung der
Armee und Städte zwangsweise requirieren. Das Dekret drohte allen, die die
Getreideüberschüsse nicht ablieferten mindestens zehn Jahre Gefängnis sowie den
Ausschluss aus der Obchina (Dorfgemeinde) sowie den Einsatz der bewaffneten
Macht im Falle des Widerstandes gegen diese Beschlagnahmungen an (Altrichter,
Band 2, 1986: S.57f.). Den „Komitees der Dorfarmut“ wies die Regierung besondere
Versorgungsaufgaben zu. Geiselerschießungen oder Einzug des Saatgetreides
stellten die extremsten Strafen bei Nichtablieferung dar. Die Hungersnot mit
Millionen Toten war nicht nur durch den Bürgerkrieg und Naturkatastrophen
verursacht worden, sondern auch durch die zu hohen Getreiderequirierung durch
die Regierung. Überall wurden die Ablieferquoten bewusst höher angesetzt mit der
Begründung die BäuerInnen würden 1/3 der Ernte heimlich zurückhalten (Figes
1998: S.794).
Schwarzhandel
und Hamstererei wurden mit drakonischen Maßnahmen bekämpft. Die Todesstrafe für
Schieber gab es schon seit Februar 1918 (Pipes, Band 2: S.649). Auch Hamsterer
konnten laut Gesetz bei Widerstand auf der Stelle erschossen werden (Kritzmann
1971: S.220). Lenin erklärte den freien Handel sogar zum „Staatsverbrechen“
(Lenin, Werke, Band 30: S.134).
Um den Ansturm
der hungernden BäuerInnen auf die Städte zu verhindern, wurde wichtige
Metropolen für Nichtansässige geschlossen. Gleichzeitig versuchte die
Sowjetregierung die Hungersnot mit der Einführung von kostenloser Versorgung
(der Stadtbevölkerung) zu begegnen. Im März 1919 verpflichte ein Dekret alle
StaatbürgerInnen zur Teilnahme an Konsumkommunen (Altrichter, Band 2, 1986:
S.91). Im Mai 1919 wurde die kostenlose Speisung für Schulkinder (ebenda:
S.91f.), im Dezember 1920 die kostenlose Abgabe von Lebensmitteln (ebenda:
S.107f.) und Massenverbrauchsartikeln an die Bevölkerung beschlossen (ebenda:
S.108). Nicht wenige ArbeiterInnen, die kostenlose Lebensmittel erhielten,
verkauften diese gleich auf dem Schwarzmarkt weiter. In Moskau und Leningrad
wurden Kantinen für die Stadtbevölkerung eingeführt.
In der ersten
Phase nach der Oktoberrevolution verstaatlichten die Bolschewiki nur die Banken
und die Großbetriebe. Am 1.Mai 1918 wurde auch das Erbrecht aufgehoben (Pipes,
Band 2, 1992: S.559). Ende November folgte schließlich eine radikale
Umgestaltung der Kleinbetriebe. Laut Dekret sollten Kleinbetriebe, die mehr als
fünf ArbeiterInnen beschäftigen und über Maschinen verfügen sowie Betriebe mit
zehn Arbeitern ohne Maschinen nationalisiert werden (Altrichter, Band 2, 1986:
S.106f.).
Mit der
Gründung der „Komitees der Dorfarmut“ im Juni 1918 wollte Lenin den Klassenkampf
und die sozialistische Umwälzung auch auf dem Land entfachen. Die Bolschewiki
versuchten die Dorfarmut gegen die „wohlhabenderen“ KulakInnen zu mobilisieren
und Staatsfarmen zu gründen. 1920 gab es ungefähr 16.000 kollektive und
staatliche Landwirtschaftsbetriebe (Figes 1998: S.777). Die Sowjetgüter im
europäischen Russland machten ca. 7 Prozent der Saatfläche aus (Kritzmann 1971:
S.XXII). 50 Millionen Hektar von „Kulakenland“ sollten laut dem „Kurzen
Lehrgang“ in die Hände der Dorfarmut und MittelbäuerInnen übergegangen sein (KAP
1972: S.268). Insgesamt betrachtet, scheiterte der Versuch, den Klassenkampf auf
das Dorf zu tragen und führte zu Aufständen, so dass die „Komitees der
Dorfarmut“ wiederaufgelöst wurden und die Partei im März 1919 Kurs auf die
Gewinnung der MittelbäuerInnen nahm.
In den Jahren des Bürgerkrieges 1918 bis 1921 kämpfte die sozialistische
Revolution ums Überleben. Schon der 1.Weltkrieg hatte eine zerrüttete Wirtschaft
hinterlassen und das bolschewistische Russland verlor wirtschaftliche wichtige
Gebiete wie die Ukraine. Zwar konnte die Politik des „Kriegskommunismus“ den
Sieg der roten über die weißen Armeen sichern. Sie hinterließ aber für die
Bolschewiki eine katastrophale politische und wirtschaftliche Lage. Die
Getreiderequirierungen führten zu hunderten lokalen BäuerInnenaufständen. An
vielen Orten erhoben sich die BäuerInnen, als der Sieg gegen die
Konterrevolution gesichert war, sofort gegen die Bolschewiki. Der größte
BäuerInnenaufstand, die „Antonow“-Bewegung, hielt Lenin für die größte
Bedrohung, der das Regime jemals ausgesetzt war (Figes 1998: S.797.).
Aller Terror zur Durchsetzung der Ernährungsdiktatur half nicht. Der Rückgang
der Produktivkräfte stärkte im Gegenteil die Tendenz zur Dezentralisierung und
die Rückkehr zur Warenwirtschaft per Schwarzmarkt, so Kritzmann. Trotz
„Kriegskommunismus“ und staatlichem Getreidemonopol wurden in vielen wichtigen
Gebieten 1918 und 1919 60 Prozent des Getreides von privaten illegalen
HändlerInnen geliefert. Eric Carr ging so gar so weit zu behaupten: „In mancher
Hinsicht tat die NEP wenig mehr, als die Handelsmethoden anzuerkennen, die sich
unter dem Kriegskommunismus trotz der Dekrete und Unterdrückungsmaßnahmen der
Regierung spontan entwickelt hatten“ (zitier nach Pipes, Band 2, 1992: S.608).
Kritzmanns damals offiziell verlegtes Buch ist eine eindruckvolle Darstellung,
dass die Einbeziehung der BäuerInnen in die staatliche Zwangswirtschaft
überhaupt nicht funktionierte. Schwarzmarkt, Tauschhandel und Hamsterei konnten
trotz drakonischer Strafen nicht eingedämmt werden.
Auch wenn die zahlreichen BäuerInnenaufstände mit brutaler Gewalt
niedergeschlagen werden konnten, mussten die Bolschewiki das Zugeständnis der
NEP an die BäuerInnenschaft machen und den freien Handel wieder zulassen. 1921
lag die Abgabenpflicht der BäuerInnen um 45 Prozent niedriger als im Vorjahr (Figes,
1998: S.808).
Auf
industriellem Gebiet sah die Bilanz des „Kriegskommunismus“ nicht viel besser
aus. Extreme Inflation und Preiserhöhungen (Pipes, Band 2, 1992: S.583f.), sowie
äußerst geringe Produktivität (ebenda: S.598) spiegelten die Krise wieder. Ende
1920 war die Industrie fast zusammengebrochen. Die Zahl der in der Industrie
beschäftigen ArbeiterInnen halbierte sich zwischen 1918 und 1921 (ebenda: S.599)
und Millionen Menschen wanderten aus den Städten aufs Land. Dass die Industrie
fast zusammengebrochen war, veranlasste Lenin im Dezember 1921 gar die Existenz
eines Proletariats anzuzweifeln: „Wir sind die Vertreter der Kommunistischen
Partei, der Gewerkschaft, des Proletariats. Entschuldigen Sie bitte. Was ist das
Proletariat? Das ist die Klasse, die in der Großindustrie arbeitet. Wo aber ist
die Großindustrie? Was ist das für ein Proletariat? Wo ist Ihre Industrie? Warum
steht sie still?“ (Lenin, Werke, Band 33, 1963: S.158).
Ohne die
Einführung der NEP 1921 hätte das bolschewistische Regime sicher nicht überleben
können. Der „Kriegskommunismus“ führte in vieler Hinsicht zu katastrophalen
Resultaten. Lenin griff daher 1921 seine schon 1918 formunierte Strategie der
Entwicklung des Staatskapitalismus in Russland wieder auf. Lenin plante nun eine
ganze geschichtliche Epoche ein, um die russische Bevölkerung zu „zivilisieren“
und an die Genossenschaften heranzuführen (Lenin, Band 3, 1984: S.860f.). Zur
Nachahmung für die KommunistInnen der anderen Länder hatte sich der
„Kriegskommunismus“ sicher nicht empfohlen.
Das Russland
des Bürgerkrieges und das China des „Großen Sprungs“ waren unterschiedliche
Gesellschaften, deren innen- und außenpolitische Lagen wenig Gemeinsamkeiten
besaßen. Als die KPCh im Sommer 1958 die Stahlkampagne startete, war China mit
der Sowjetunion verbündet und hatte fast zehn Jahre Friedenszeit auf dem
Festland hinter sich. Wenn der russische „Kriegskommunismus“ eine Unterordnung
der Wirtschaft und Gesellschaft unter die Bedürfnisse der Armee darstellte, so
wurde in China von der Regierung die gegenteilige Politik betrieben: Um den
wirtschaftlichen Aufbau zu forcieren, wurde das stehende Heer massiv verkleinert
und die Rüstungsausgaben gesenkt. Ein großer Krieg war trotz der Jinmen-Krise im
Herbst 1958 nicht zu erwarten. Mao gab den Befehl, nicht auf amerikanische
Schiffe zu schießen und glaubte nicht an einen Krieg mit den USA.
Die
Militarisierung der Arbeit und die Kollektivierung des Dorflebens waren in
erster Linie Mittel zur forcierten Wirtschaftsentwicklung und keine
Kriegsvorbereitung. Mao ordnete die gesamte Wirtschaftplanung der
Stahlproduktion unter und nicht dem militärisch-industriellen Komplex, wie nach
1964 mit dem Aufbau der „3.Linie“ im Westen Chinas.
Militärische
Prinzipien spielten auch ohne Krieg eine größere Rolle in Wirtschaft und
Gesellschaft als in Russland. Die Volksmiliz war für die Partei das Mittel, eine
neue „industrielle Arbeitsdisziplin“ auf die BäuerInnen zu übertragen und auch
die „natürlichen“ Lebensrhythmen des Dorfes zu beseitigen um so ein neues
„rationales Dorf“ zu schaffen, in dem Versorgung, Wohnen, Bestattung und
Hochzeit den Bedürfnissen der Produktion untergeordnet wurden.
Der von Gao Hua
verwendete Begriff des „Kasernensozialismus“ trifft den Kern der Sache besser
als jener des „Kriegskommunismus“. Gao Hua dehnt den Begriff aber auf die
gesamte Mao-Zeit aus, was meiner Meinung nach nicht zutrifft, da die
Militarisierung der ländlichen Arbeitskräfte wieder rückgängig gemacht wurde und
die Organisationsstrukturen der Volkskommune und Produktionsbrigaden wieder auf
den „natürlichen“ Grenzen des Dorfes aufbauten. Außerdem war der Versuch der
Schaffung einer rationellen Organisation des Dorfes mit dem versuchtem Übergang
zum Kommunismus und einer radikalen Umwälzung der Eigentumsverhältnisse
verbunden, weshalb ich das Programm des „Großen Sprungs“ als
„Kasernenkommunismus“ bezeichnen würde.
Trotz dieser
Unterschiede gab es einige Gemeinsamkeiten zwischen dem russischen
„Kriegskommunismus“ und dem chinesischen „Kasernenkommunismus“. Die Ideologie
der Bolschewiki während des Bürgerkrieges war zutiefst bäuerInnenfeindlich.
Jegliche Form von Handel wurde generell als Kapitalismus verteufelt und als der
Hunger die Städte bedrohte, wurden „nicht nur die Überschüsse“ (Lenin) der
BäuerInnen mit Hilfe von Terrormaßnahmen gnadenlos requiriert. Die Hungernden
wurden von den Städten ferngehalten und Schwarzhändler erschossen.
Der „Große
Sprung“ versprach ursprünglich den BäuerInnen nach „drei Jahren bitterem Krieg“
ein glückliches Leben und machte das Dorf zur Ausgangsbasis der Umwälzung. Als
nach der guten Ernte 1958 auf Grund der Regierungspolitik 1959/60 der große
Hunger auf dem Land ausbrach, reagierten die chinesischen KommunistInnen genauso
wie die Bolschewiki: auch wenn es den Tod von Millionen BäuerInnen bedeutete,
die Strategie wurde nicht geändert. Die Regierung exportierte weiterhin Getreide
ins Ausland und nahm den BäuerInnen das letzte Getreide weg, um Städte und
privilegierte Gruppen des Systems, wie IndustriearbeiterInnen, Kader oder
Intellektuelle, weiter versorgen zu können. Im China der Jahre 1959 bis 1960 war
die staatliche Aufkaufsquote von Getreide die höchste seit 1953, aber die
Produktion pro Kopf die niedrigste seit Jahren (Walker 1984: S. 167). Wie Mao
später eingestand, hatte man den Teich ausgetrocknet, um die Fische zu fangen
(ebenda: S. 155). In den neueren chinesischen Veröffentlichungen wird der
Bevölkerungsverlust von 1959 bis 1961 häufig auf 40 Millionen beziffert (Jiang /
Zhou / Jiu, 1998: S. 1). Auch in China wurde den hungernden BäuerInnen verboten,
sich selbst zu helfen. Die Städte wurden abgeriegelt und die Flucht aus den
Dörfern unterbunden. Die Entstehung einer großen Schattenwirtschaft und eines
Schwarzmarktes konnte die Regierung – im Gegensatz zu Russland – verhindern;
dort versorgte dieser immerhin die Hälfte der Bevölkerung mit Getreide. Die
russischen BäuerInnen waren 1920 eben KleinproduzentInnen und keine
„Angestellten“ einer Volkskommune.
Um die Frage zu
beantworten, warum der Staat die hungernden BäuerInnen und den Schwarzmarkt
unterdrücken konnte, muss man sich die Umwälzung der Eigentumsverhältnisse vom
Herbst 1958 vor Augen halten. Die chinesischen BäuerInnen hatten ihre
Subsistenzgrundlage verloren. Die Parzellen zur privaten Nutzung, ihr Hausvieh
und Obstbäume gingen vieler Orts in die Hände der Kommune über. Kochtöpfe wurden
eingeschmolzen und es war häufig verboten, zu Hause zu kochen. Mit der Ersetzung
der häuslichen Versorgung durch die Volksküchen waren die BäuerInnen dem Staat
komplett ausgeliefert. Wenn es in den Volksküche nichts mehr gab und die Flucht
von den lokalen Kadern effektiv unterbunden wurde, dann blieb den BäuerInnen nur
noch, zu verhungern.
Im Gegensatz
dazu waren die russischen BäuerInnen KleinproduzentInnenen innerhalb der
Dorfgemeinde auf staatlichem Boden. Sie produzierten ohne Plan und waren
EigentümerInnen ihres Produkts. Der Staat versuchte ihnen das Produkt per
Zwangsrequirierung wieder abzunehmen. Die Staatsmacht war auf dem russischen
Dorf viel schwächer als in China. Während die Volksbefreiungsarmee die
Bodenreform per Bürgerkrieg durchgesetzt hatte, führten die russischen
BäuerInnen die „schwarze Umverteilung“ selber durch und die meist als
Eindringlinge von außen empfundenen Bolschewiki legalisierten diese Umwälzung
mit dem „Dekret über Grund und Boden“ erst im nachhinein.
Der Kern der
Revolution des „Großen Sprungs“ bildete die Transformation der
Eigentumsverhältnisse vom sozialistischen, kollektiven und individuellen
Eigentum zum „Eigentum des ganzen Volkes“. In Russland wurde während des
„Kriegskommunismus“ die komplette Vergesellschaftung des ländlichen Eigentums in
naher Zukunft nie in Erwägung gezogen, auch wenn in der Industrie Kleinbetriebe
verstaatlicht wurden. Der Kern der Revolution des „Kriegskommunismus“ bildete
zumindest nach der Auffassung des damals dominierenden linken Parteiflügels die
Abschaffung des Geldes durch die Einführung einer „proletarischen
Naturalwirtschaft“, in der der Staat alle Produkte verteilte. Soweit wollte Mao
nicht gehen: Chen Bodas Forderungen, das Geld abzuschaffen, wies er zurück und
ab der 1.Zhengzhou-Konferenz im November 1958 unterstrich das ZK wieder die
Notwendigkeit der Entwicklung der Warenwirtschaft.
Schluss:
Der Kriegs- und Kasernenkommuismus als Schlüsselkrise in der Geschichte des
Staatssozialismus
Die beiden
großen geschichtlichen Versuche direkt in den Kommunismus überzugehen, in
Russland 1919 und in China 1958, endeten im Desaster. Die Folge des
Frontalangriffs auf die LebensmittelproduzentInnen und eigentlichen
BündnispartnerInnen der Revolutionen, die BäuerInnen, war in beiden Ländern eine
Hungersnot mit Millionen von Toten. Beide Regime setzten alle Energie ein, um
die Stadtbevölkerung und privilegierten Gruppen durch gewaltsame Requirierungen
des Getreides der BäuerInnen zu retten.
Die Macht
konnten die Kommunistischen Parteien zwar halten, doch Zugeständnisse an die
BäuerInnen wurden unabwendbar. Die Volkskommune von 1961 in China besaß wieder
Parzellen zur privaten Nutzung und baute auf den traditionellen Dorfstrukturen
auf. Nie wieder versuchte Mao diese Ordnung anzugreifen und zu höheren
Eigentumsformen überzugehen. In Russland musste die NÖP eingeführt werden, damit
die Bolschewiki nicht von den „grünen“ Aufständen gestürzt wurden. Selbst
drakonische Maßnahmen konnten Schwarzmarkt und Überlebenskampf der BäuerInnen
keinen Einhalt gebieten. Von der Illusion, die Menschen in Arbeitsarmeen zu
organisiert und die Produktion nach militärischen Prinzipien zu leiten, mussten
sich Bolschewiki und MaoistInnen verabschieden. Auch wenn die Phasen des Kriegs-
und Kasernenkommunismus in Russland und China nicht lange dauerten, zerstörten
sie doch grundlegend das Verhältnis von Staat und Bauernschaft. In beiden
Ländern wurden diese Katastrophen nie aufgearbeitet. Lenin gab dem Bürgerkrieg
die Schuld, Mao den Naturkatastrophen sowie dem Abzug der sowjetischen
ExpertInnen. In der Sowjetunion führte dies dazu, dass Stalin 1929 einen
erneuten kriegskommunistischen Vorstoß unternahm, der zu einer noch größeren
Hungersnot führte. Bei der weiteren Aufarbeitung der Niederlage des Sozialismus
könnte sich der Fokus auf den „Kriegskommunismus“ als fruchtbar erweisen.
e-mail:
anton.pam/ at /gmx.net
Abkürzungen
GNN -
Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung
Jgyl -
Jianguo yilai zhongyao wenjian xuanbian
(Eine
Auswahl wichtiger Dokumente seit der Staatsgründung), siehe „Literatur“:
Zhonggong Zhongyang Wenxian Yanjiushi (Hrsg.) (1992-1998)
KPCh -
Kommunistische Partei Chinas
Mzdwg -
Jianguo yilai Mao Zedong wengao (Manuskripte und Entwürfe von Mao Zedong seit
der Staatsgründung), siehe „Literatur“: Zhonggong Zhongyang Wenxian
Yanjiushi (Hrsg.) (1987-1996)
Literatur
-
Altrichter, Helmut (Hrsg.) (1986): Die Sowjetunion – Von der Oktoberrevolution
bis zu Stalins Tod, zwei Bände, dtv, München.
-
Bettelheim, Charles (1975): Klassenkämpfe in der UdSSR 1917-1923, Band 1,
Oberbaumverlag, Berlin (W).
-
Figes, Orlando (1998): Die Tragödie eines Volkes – Die Epoche der russischen
Revolution 1891 bis 1924, Berlin Verlag, Berlin.
-
Gao, Hua (1998): Dayuejin yundong yu guojia quanli de kuozhang: yi Jiangsu Sheng
wei li (Die Bewegung des Großen Sprungs nach vorne und die Ausdehnung der
Macht des Staates am Beispiel der Provinz Jiangsu), in: Ershiyi Shiji, Nr.
48,
http://www.chinafamine.org/famine/Research/gaohua02.html (Stand 1.11.03).
-
GNN (Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung) (Hrsg.)
(1988): Volksrepublik China - Antiimperialismus, Sozialismus, Kulturrevolution,
Köln.
-
Jiang, Pei / Zhou, Dexi / Shen, Jiuquan (1998): Lao xinwen 1959-1961 (Alte
Nachrichten), Tianjin.
-
Kritzmann, Leo N. (1971): Die heroische Periode der großen russischen
Revolution, Verlag Neue Kritik, Frankfurt (M).
-
Kommunistischer Arbeiterbund (Marxisten-Leninisten) (Hrsg.) (1972): Geschichte
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) – Kurzer Lehrgang,
Tübingen. (KAP)
-
Lenin, W.I.: Gesammelte Werke, Berlin (Ost).
-
Lenin, W.I. (1984): Ausgewählte Werke in drei Bänden, Berlin (Ost).
-
Li, Rui (1999): „Dayueyin” qinshiji (Der „Große Sprung nach vorne“ – Erlebte
Geschichte), zwei Bände, Haikou.
-
Martin, Helmut (Hrsg.) (1982): Mao Zedong - Texte, sieben Bände, München.
-
Marx, Karl / Engels, Friedrich: Werke, Berlin (Ost).
-
Mao Zedong (1968): Ausgewählte Werke, Peking.
-
Pipes, Richard
(1992/1993): Die russische Revolution, Band 2 und 3, Berlin.
-
Preobrazenskij, E. (1971): Die neue Ökonomik, Verlag neuer Kurs, Berlin (West).
-
Schurmann,
Franz (1968): Ideology and Organization in Communist China, second Edition,
University of California Press, Berkeley.
-
Stalin, Josef (1950): Gesammelte Werke, 13 Bände, Berlin (Ost).
-
Trotzki, Leo (1920): Terrorismus und Kommunismus – Anti-Kautsky, Nachdruck Olle
und Wolter, Berlin.
-
Trotzki, Leo (1979): Die verratene Revolution – Was ist die Sowjetunion und
wohin treibt sie?, Dortmund.
-
Walker, Kenneth
R. (1984): Food Grain Procurement and Consumption in China, Cambridge.
-
Wu, Ren (1958):
Renmin gongshe yu gongchanzhuyi (Die Volkskommunen und der Kommunismus),
Beijing.
-
Wu, Zhipu (1958):
Lun Renmin gongshe (Über die Volkskommune), in: Xuanchuan Jianbao,
25.8.1958.
-
Zhonggong Zhongyang
Wenxian Yanjiushi (Forschungsbüro des ZK der KPCh für Dokumente) (Hrsg.)
(1987-1996): Jianguo yilai Mao Zedong wengao (Mansukripte und Entwurfe von
Mao Zedong seit der Staatsgründung), Beijing.
-
Zhonggong Zhongyang
Wenxian Yanjiushi (Forschungsbüro des ZK der KPCh für Dokumente) (Hrsg.)
(1992-1998): Jianguo yilai zhongyao wenjian xuanbian (Eine Auswahl wichtiger
Dokumente seit der Staatsgründung), Beijing.
Im „Manifest“ hießen zwei Forderungen der Kommunisten: „8. Gleicher
Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den
Ackerbau. 9. Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, Hinwirken
auf die allmähliche Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land.“
(Marx/Engels, Band 4, S.481).
|
